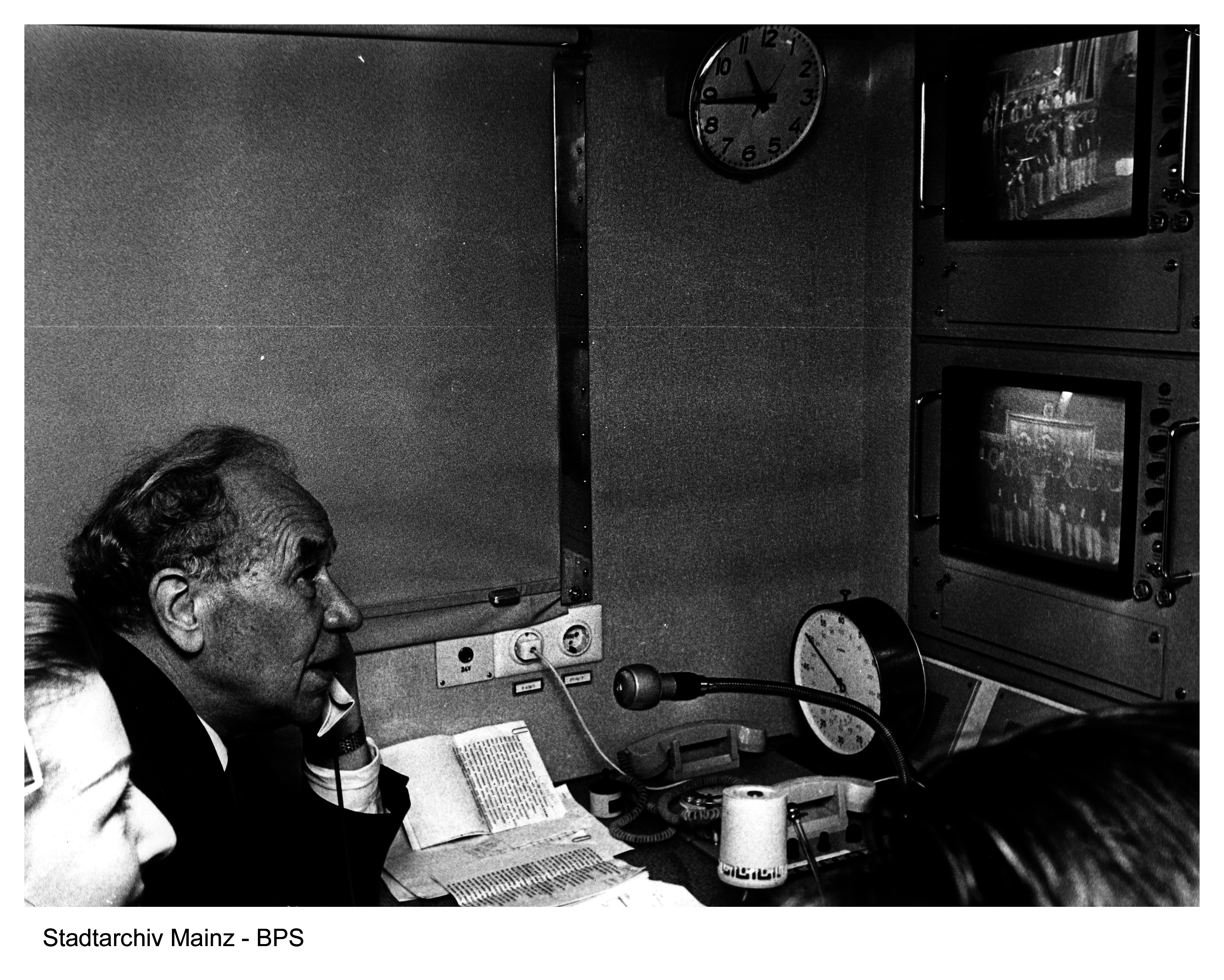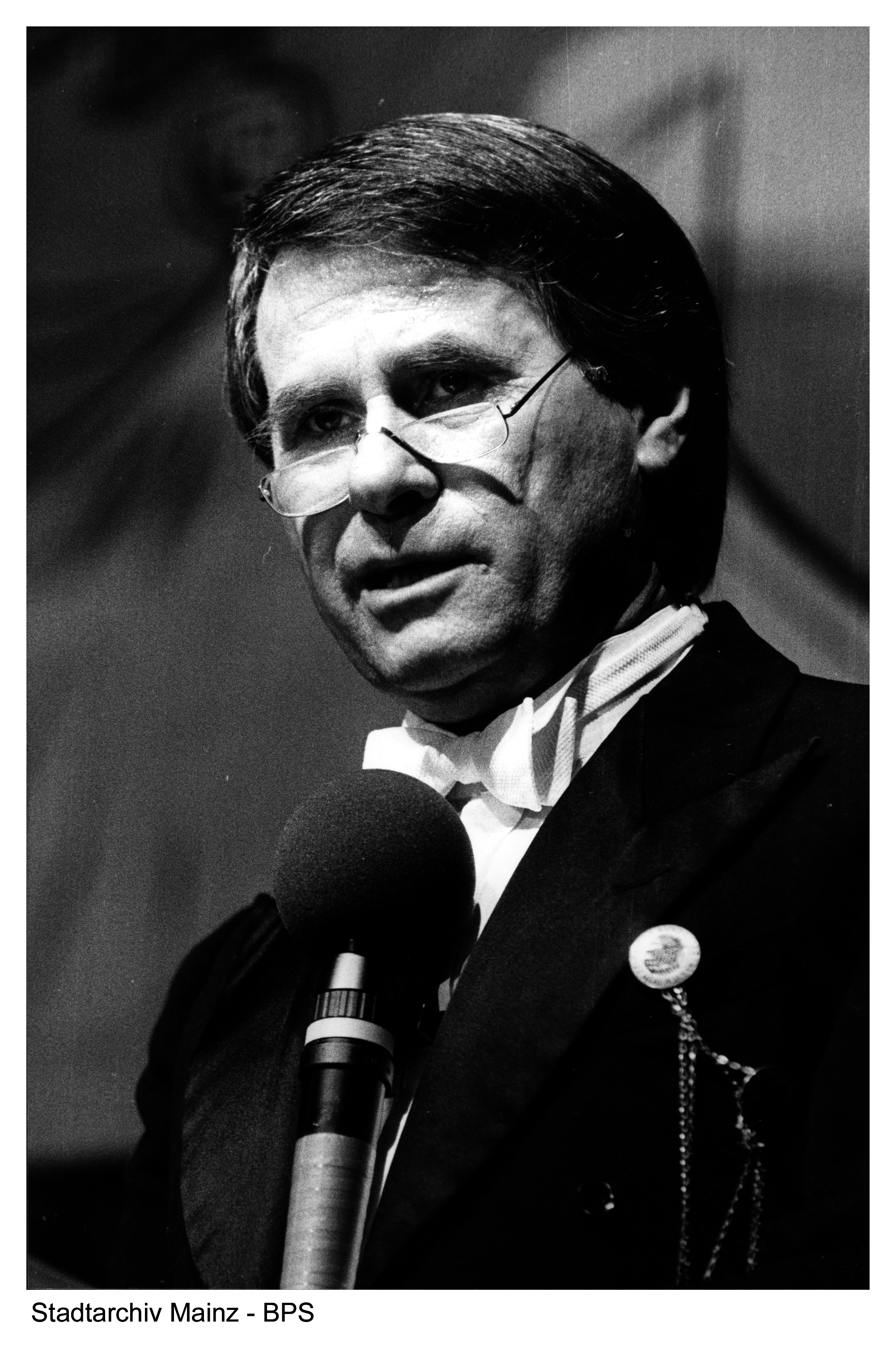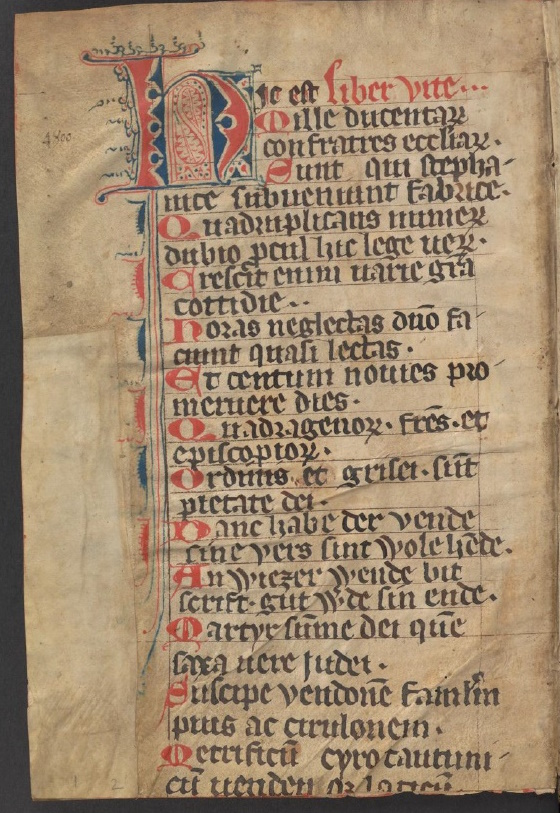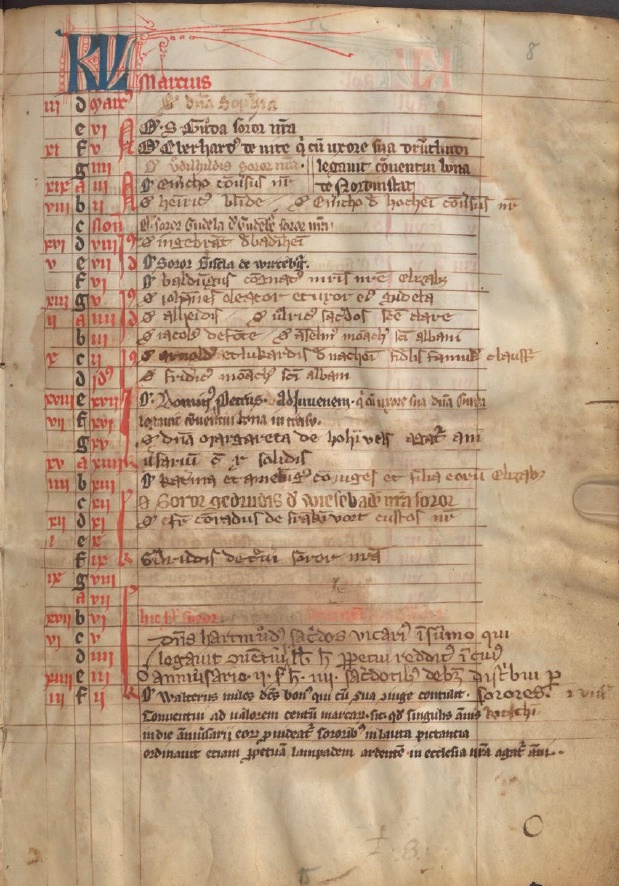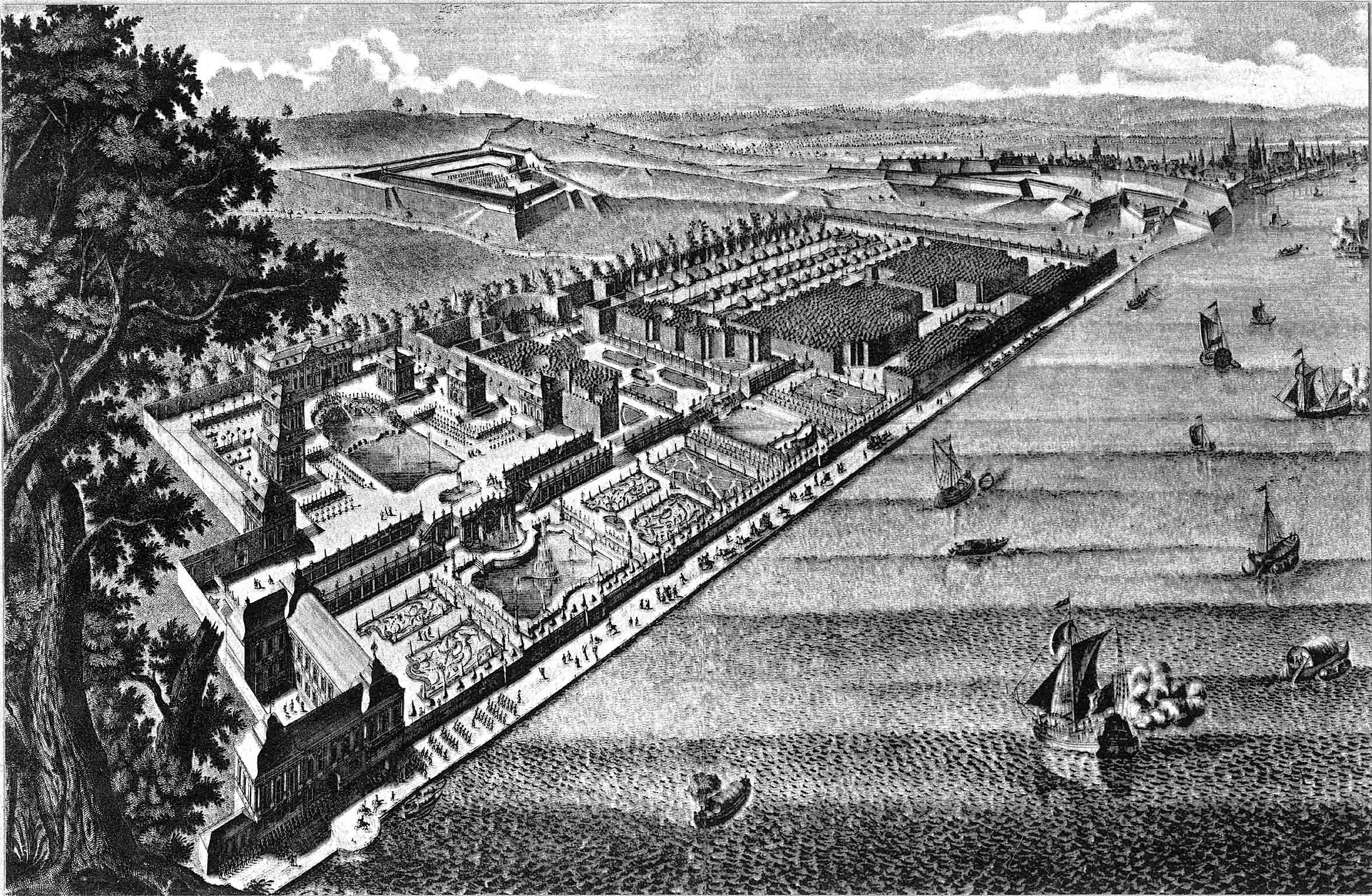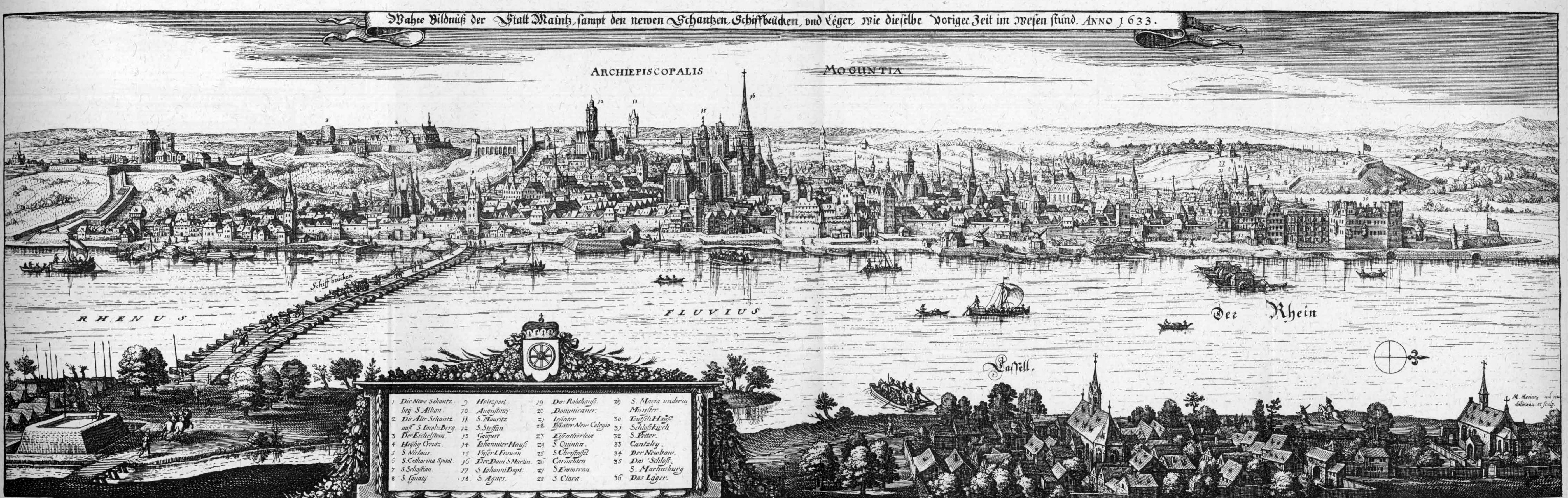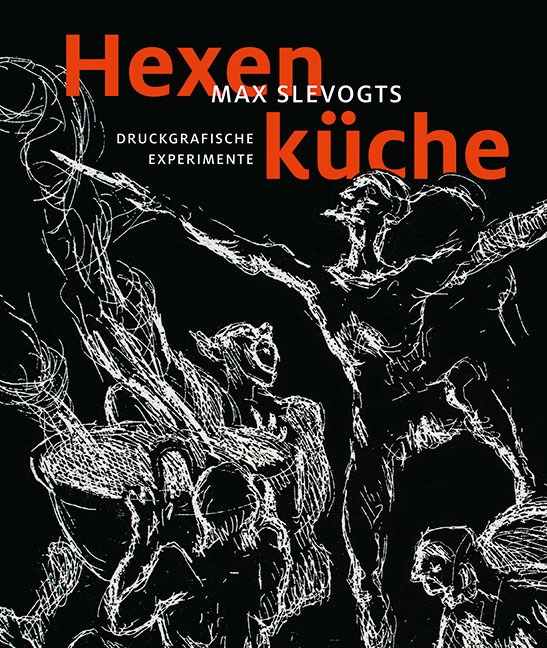0.1.1.Faszination Fotografie: Vorstellung des Jahrgangs 2023/2024 der Mainzer Zeitschrift (Band 118/119)
Faszination Fotografie:
Vorstellung des Jahrgangs 2023/2024 der Mainzer Zeitschrift (Band 118/119)
Unser Redakteur der Mainzer Zeitschrift, Prof. Dr. Wolfgang Dobras, stellt den druckfrischen Jahrgang 2023/24 des vom Mainzer Altertumsverein herausgegebenen Jahrbuchs vor. Im Anschluss gibt es Kurzvorträge zum Schwerpunktthema des neuen Bandes, das neuen Forschungen zur frühen Fotografie im Rhein-Main-Gebiet gewidmet ist. Prof. Dr. Peter Haupt (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Susanne Speth (Stadtarchiv Mainz), Regina Zölßmann (Stadtarchiv Mainz) und Dr. Andreas Linsenmann (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) werden die Pionierzeit der Fotografie ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mainz und Übersee anhand der Lebensläufe von drei wenig bekannten Persönlichkeiten beleuchten: August Brauneck, Peter Metz und Konrad Schollmayer. Die Referentinnen und Referenten bieten neue Einblicke in die wirtschaftliche Situation und das fotografische Werk professioneller Fotografen, würdigen aber auch das Schaffen eines hochmotivierten Amateurfotografen jener Zeit.
Die Aufsatzfassungen der Vorträge finden Sie im neuen Band der Mainzer Zeitschrift, den Sie an diesem Abend direkt in Empfang nehmen können. (Inhaltsverzeichnis).
Datum: Montag, 13. Januar 2025
Uhrzeit: 18.30 Uhr
Ort: Stadtarchiv Mainz, Rheinallee 3B
0.1.2.Ludwig Lindenschmit d.Ä. (1809-1893)
Ludwig Lindenschmit d.Ä. (1809-1893)
Dr. Annette Frey (Leibniz-Zentrum für Archäologie LEIZA)
Ludwig Lindenschmit der Ältere gehört zu den Pionieren der Archäologie. Als ausgebildeter Künstler war er hauptberuflich als Lehrer tätig.
Seine eigentliche Leidenschaft aber gehörte der Altertumskunde. Er war Mitbegründer und Konservator des Mainzer Altertumsvereins und 1852 einer der Hauptinitiatoren des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM). Durch die Tätigkeiten für den MAV, den Aufbau der Sammlung des RGZM und seine Publikationstätigkeit war er bald in ein europaweites Netzwerk eingebunden, in dem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Grundsteine für die moderne, wissenschaftliche Archäologie gelegt wurden. Auch in Mainz und Umgebung war er bestens vernetzt. Letztlich verdankt er diesen vielfältigen Kontakten auch den Erfolg „seines“ RGZM, das bis heute existiert – seit 2023 unter dem Namen Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA).
Datum: Montag, 3. Februar 2025
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz
0.1.3.Bauernkrieg und Bürgeraufstand: die Ereignisse in der Reisdenzstadt Mainz 1525

- Detail aus dem zur Erinnerung an die Niederschlagung des Bauernaufstandes errichteten Mainzer Marktbrunnen. Foto: Prof. Dr. W. Dobras
Bauernkrieg und Bürgeraufstand: die Ereignisse in der Residenzstadt Mainz 1525
Prof. Dr. Wolfgang Dobras (Stadtarchiv Mainz)
Bis heute erinnert der Mainzer Marktbrunnen an den Bauernkrieg und sein blutiges Ende. Was sich im Frühjahr 1525 in der Hauptstadt des Mainzer Kurfürsten ereignete und wer von den Bürgern und aus welchen Gründen sich empörte, versucht der Vortrag zu rekonstruieren. Durch einen neuen Urkundenfund lässt sich erstmals im Detail nachvollziehen, wie der in 31 Artikeln formulierte Beschwerdekatalog der aufständischen Bürger mit der Obrigkeit ausgehandelt wurde. Worin sich die Mainzer Forderungen von anderen Programmen des Bauernkrieges unterschieden, soll am Schluss bilanziert werden.
Termin: Montag, 17. März 2025
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz
0.1.4.Steinerne Kreuzigungsgruppen auf Kirchhöfen um 1500: Stiftung und Funktion
Steinerne Kreuzigungsgruppen auf Kirchhöfen um 1500: Stiftung und Funktion
Tessa Maria Leicht, M.A. (Universität Heidelberg)
Ab 1500 entstehen am Mittel- und Niederrhein, besonders aber im Mainzer Raum, überlebensgroße Kreuzigungsgruppen aus Stein. Sie finden sich meist auf Kirchhöfen und treten dort fast unmittelbar ohne erkennbare Vorläufer auf. Der Vortrag untersucht die Umstände ihrer Stiftung, also ihre Auftraggeber und deren Absichten. An Beispielen wie der Gruppe von St. Ignaz im Mainzer Dommuseum werden Funktion und Bedeutung der Denkmäler neu bewertet. Aufbau, Inschriften und Standorte deuten auf kommunale Formen von Totengedenken, Frömmigkeit und Jenseitsvorsorge hin.
Datum: Montag, 6. Oktober
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55116 Mainz
0.1.5.Vortrags- und Diskussionsabend: Rettung gefährdeter Grabdenkmäler auf dem Hauptfriedhof Mainz
Rettung gefährdeter Grabmäler auf dem Hauptfriedhof Mainz
Mit diesem Vortrags- und Diskussionsabend stellt der Mainzer Altertumsverein seine Initiative zur Rettung der vom Verfall bedrohten Grabmäler auf dem Mainzer Hauptfriedhof vor.
Der 1803 unter Kaiser Napoleon angelegte Mainzer Hauptfriedhof wird maßgeblich durch die Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten sowie durch zahlreiche künstlerisch aufwendige Grabmäler geprägt und ist somit ein einmaliges Zeugnis Mainzer Stadtgeschichte. In Kurzvorträgen werden zunächst die Geschichte und der aktuelle Zustand der Friedhofsanlage und der Grabmäler beleuchtet und im Anschluss mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert.
Das detaillierte Programm zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.
Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Ort: Peter-Cornelius-Konservatorium, Binger Str. 18
0.1.6.Votrag anlässlich der Jahresmitgliederversammlung: ...und ewig ruft das Fernsehen - die Eroberung und Behauptung des Bildschirms durch die Mainzer Narren
...und ewig ruft das Fernsehen - Die Eroberung und Behauptung des Bildschirms durch die Mainzer Narren
(Votrag im Anschluss an die Mitgliederversammlung)
Dr. Diether Degreif (Mainz)
Handkäs' mit Musigg, Fleischworscht mit Paarweck, Wein im Schoppenglas, Newweling und Haddekuche, der Dom, die Altstadt - das alles gehört zu Mainz. Und natürlich die Fastnacht. Seit nunmehr 70 Jahren begeistert die Live-Sitzung "Mainz bleibt Mainz" und "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" jedes Jahr aufs Neue an einem Abend vor Fastnacht ein nach wie vor großes Publikum im Saal und vor dem Bildschirm. In dem Vortrag wird das Medienereignis aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
Wie entwickelte sich aus dem lokalen Volksfest Fastnacht ein begehrter Artikel auf der Mattscheibe? Wer waren die maßgeblichen Initiatoren für das Zustandekommen der Sendung? Welche Intentionen verband und verbindet man mit der Live-Sendung? Unterliegt das närrische Geschehen auf der Bühne einer bewussten oder unbewussten Einflussnahme seitens der Sendeanstalten? Wie steht es um das Selbstverständnis der Narren in und aus der Bütt? Ist Fernsehfastnacht auch ein Wirtschaftsfaktor?
Abschließend werden mögliche Antworten gegeben auf die Frage "Quo vadis Bildschirm-Fastnacht?"
Datum: Montag, 10. November 2025
Uhrzeit: ca. 19 Uhr (im Anschluss an die Mitgliedervesammlung)
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55115 Mainz
0.1.7.Bücher der Toten, Bücher des Lebens. Nekrologe im mittelalterlichen Mainz
Bücher der Toten, Bücher des Lebens. Nekrologe im mittelalterlichen Mainz
Prof.Dr. Nina Gallion (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Im mittelalterlichen Mainz gab es zahlreiche Klöster und Stifte, die das Stadtbild prägten und auf das Engste mit der urbanen Gesellschaft und ihren Frömmigkeitspraktiken verbunden waren. Eine zentrale Aufgabe dieser Gemeinschaften betraf nämlich das Totengedenken, bei dem man an die verstorbenen Stifter und Stifterinnen erinnerte. Zu diesem Zweck führten die geistlichen Institutionen Nekrologe, die als Totenverzeichnisse die Organisation des Gedenkens unterstützten. Der Vortrag beleuchtet die Charakteristika dieser faszinierenden Überlieferung und fragt nach ihren spätmittelalterlichen Entstehungsbedingungen.
Datum: Montag, 1. Dezember 2025
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55116 Mainz
0.2.1.Vom Bombenkrieg gezeichnet. Vergessene Fragmente erzählen Geschichte.
Vom Bombenkrieg gezeichnet. Vergessene Fragmente erzählen Geschichte.
Dr. Winfried Wilhelmy (Dom- und Diözesanmuseum Mainz)
Kriege sind heute wieder allgegenwärtig. Wohin sie führen, zeigt die Zerstörung von Mainz am 27. Februar 1945. Am Nachmittag dieses Tages wurden 80 Prozent der Stadt vernichtet und in dem anschließenden Feuersturm kamen rund 1200 Bewohnerinnen und Bewohner ums Leben. Aus Anlass der 80. Wiederkehr dieses Schreckenstages hat das Dommuseum seine Depots gesichtet und zahlreiche Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum wiederentdeckt, die vormals die Stadt zierten: herabgestürzte Hausmadonnen, zerbrochene Portalfiguren, demolierte Wappensteine, zerschmolzene Bauplastik. In einer Exklusiv-Führung für die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins durch Dr. Winfried Wilhelmy werden diese Fragmente im Kontext des Zerstörungstages von Mainz vorgestellt.
Datum: 19. April 2025
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Dom- und Diöseanmuseum Mainz
Unkostenbeitrag: 3,50 Euro / Person
Um verbindliche Anmeldung beim MAV wir zwecks Planung der Veranstaltung gebeten.
0.3.1.Führung durch Kloster und Kirche der Mainzer Karmeliter

- Karmeliterkirche und Kloster Mainz, Foto: Ursula Rudischer[Bild: Foto: Ursula Rudischer]
Führung durch Kloster und Kirche der Mainzer Karmeliter
Kerstin Albers M.A. (Archiv des Landtags Rheinland-Pfalz)
Ende des 13. Jahrhunderts werden die Karmeliter in Mainz erstmals urkundlich erwähnt. Der Bettelorden trat im Spätmittelalter im Mainzer Stadtgeschehen auch durch das Engagement für die 1477 gegründete Mainzer Universität hervor. 1802 wurde das Karmeliterkloster im Zuge der Säkularisation aufgehoben. Mainzer Bürger protestierten Anfang des 20. Jahrhunderts gegen den geplanten Abriss der Kirche und setzten sich für eine Wiederansiedelung des Ordens ein. 2024 feiern daher die Karmeliter das Jubiläum "100 Jahre Wiederkehr des Karmel in Mainz". Die Führung beleuchtet die über 700jährige Geschichte von Karmeliterkloster und -kirche bis zu den heutigen Aufgaben und Herausforderungen.
Datum: Mittwoch, 19. März 2025
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Karmeliterkloster, Karmeliterstraße 7, Mainz
Treffpunkt: Am Eingang des Karmeliterklosters (nicht der Kirche selbst): etwa 20 m vom Haupteingang der Kirche in der Karmeliterstraße 7 (am Ende der Karmeliterstraße, Richtung Kreuzung Rheinstraße)
0.3.2.Exkursion nach Worms
Burchard-Jahr 2025: Romanische Kirchen in Worms
(Exkursion in Kooperation mit dem Wormser Altertumsverein)
Führung durch Dr. Burkhard Keilmann und Dr. Irene Spille
Der Todestag des Wormser Bischofs Burchard jährt sich 2025 zum 1000. Mal, ein Anlass, seiner zu gedenken. Nicht nur durch seine Vita ist sein Leben und Werk recht gut beschrieben, auch in den von ihm verfassten Schriften zeigt sich seine Bedeutung als Theologe, Politiker und Jurist. Elemente aus seinen Dekreten sind beispielsweise im gültigen Kirchenrecht erhalten. Zudem war er ein beachtenswerter Bauherr, der Baumaßnahmen an den vier großen, stadtbildprägenden romanischen Kirchen der Wormser Innenstadt vornehmen ließ und auch an der Stadtmauer tätig wurde. Nicht nur für Stadt und Bistum Worms war Bischof Burchard (1000-1025) von höchster Bedeutung, sondern auch für das Reich. Bis heute hat er deutliche Spuren seines Wirkens hinterlassen. Auf dem Rundgang werden die vier romanischen Kirchen einschließlich des Domes besichtigt, verbunden mit Informationen zu Burchards Wirken als Geistlicher und Stadtherr. Dabei wird sich auch die exklusive Gelegenheit bieten, den Ostchor des Domes mit der romanischen Bauplastik sowie dem prachtvollen barocken Hochaltar und dem Chorgestühl zu besuchen sowie die romanische Apsis hinter dem Hochaltar von St. Paul. Die fachkundige Führung übernehmen die beiden Vorsitzenden des Wormser Altertumsvereins, der Historiker Dr. Burkard Keilmann und die Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin Dr. Irene Spille.
Termin: 12. April 2025
Treffpunkt: Hauptbahnhof Worms, Eingangshalle, 9.45 Uhr
Anreise: Individuelle Anfahrt nach Worms. Es besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen Bahnfahrt mit dem Regionalexpress (Abfahrt 9:13 Uhr ab Hauptbahnhof Mainz); Treffpunkt 9:00 Uhr am Bahnsteig (Teilnahme bitte bei Anmeldung angeben)
Verpflegung: Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen (Selbstzahler*innen, bitte bei Anmeldung angeben)
Dauer: bis gegen 17 Uhr in Worms. Möglichkeit zur gemeinsamen Rückfahrt nach Mainz ab Hauptbahnhof Worms um 17.20 Uhr.
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis 7. April 2025 per E-Mail an info(at)mainzer-altertumsverein.de
Bitte geben Sie dabei auch an, ob Sie die gemeinsame Anreise (Fahrkarten müssen hierbei eigenständig erworben werden) und die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen wahrnehmen möchten.
0.3.3.Führung in Kastel auf den Spuren der Römerzeit
- [Bild: Dr. P. Karn (MAV)]
Führung in Kastel auf den Spuren der Römerzeit
Gernot Frankhäuser (Landesmuseum Mainz, Beiratsmitglied MAV) und Karl-Heinz Kues (Gesellschaft für Heimatgeschichte)
(Mainz-)Kastel gehört zu den Orten, die seit der Antike ihren Namen beibehalten haben. Im Ort selbst ist heute aber so gut wie nichts von seinem römischen Ursprung zu sehen. Die heutige Große Kirchstraße folgt aber noch der römischen Verbindung nach Osten - auf deutlich höherem Niveau gelegen als ursprünglich. 1986 wurden unter ihr die stattlichen Überreste eines "Ehrenbogens" gefunden. Dieses nördlich der Alpen einmalige Bauwerk ist unser Ziel.
Treffpunkt ist aber zunächst das Museum Castellum, wo uns Karl-Heinz Kues von der Gesellschaft für Heimatgeschichte begrüßt und einige der römischen Exponate vorstellt.
Datum: Freitag, 12. September 2025
Uhrzeit: 16 Uhr
Treffpunkt: Eingang Museum Kastellum, Reduit am Rheinufer, Mainz-Kastel
Teilnahmegebühren sowie Eintritt werden nicht erhoben. Wir weisen aber gerne auf die Spendenvase im Museum hin!
0.3.4."Mainzer Persönlichkeiten" auf dem Hauptfriedhof

- Familiengrablege der Familie Lindenschmit. Ludwig Lindenschmit der Ältere war Mitbegründer des MAV.[Bild: A. Frey (LEIZA)]
Der Mainzer Altertumsverein stellt im Oktober seine Initiative zur Rettung der vom Verfall bedrohten Grabmäler auf dem Mainzer Hauptfriedhof vor. Zum Auftakt bieten wir bereits zum Tag des offenen Denkmals am 14.9.25 Führungen zu "Mainzer Persönlichkeiten" an.
Der 1803 unter Kaiser Napoleon angelegte Mainzer Hauptfriedhof wird maßgeblich durch die Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten sowie durch zahlreiche künstlerisch aufwendige Grabmäler geprägt und ist somit ein einmaliges Zeugnis Mainzer Stadtgeschichte. Viele der Gräber erinnern auch an Personen, die eng mit dem MAV verbunden sind und sich mit ihm für wichtige städtische Belange engagiert haben.
Datum: 14.9.2025
Uhrzeit: 14 Uhr und 15 Uhr
Treffpunkt: Eingang Untere Zahlbacher Straße (Trauerhalle).
0.3.5.Wege in die Unterwelt? Führung zur Ostkrypta und Nassauer Kapelle im Mainzer Dom
- [Bild: Dr. P. Karn (MAV)]
Wege in die Unterwelt? Führung zur Ostkrypta und Nassauer Kapelle im Mainzer Dom
Dr. Felicitas Janson (Akademie des Bistums Mainz) und Dr. Georg Peter Karn (Vorsitzender MAV)
Es gibt Orte im Mainzer Dom, die nicht öffentlich zugänglich gemacht werden können und über die schon immer etwas Geheimnisvolles berichtet wird. In dieser Sonderführung werden wir baugeschichtlichen Fragen und auch den spannenden Fragen der Restaurierung des 20. Jahrhunderts nachgehen, darunter die seinerzeit spektakuläre Unterfangung der Fundamente des Domes ab 1909. Aber auch die Ausstattung und symbolische Bedeutung der Orte wird erläutert.
Datum: Dienstag, 4. November
Uhrzeit: 16 Uhr
Treffpunkt: Mainzer Dom, Ostchortreppe
Wegen der beschränkten möglichen Zahl an Teilnehmenden bitten wir Sie um Anmeldung bis Montag, 20. Oktober 2025
(E-Mail: info@mainzer-altertumsverein.de oder Tel. 0157 / 559 776 88)
0.3.6.Führung auf dem Mainzer Hauptfriedhof
Nach dem Start unserer Crowdfunding-Aktion zur Rettung von Grabsteinen auf dem Hauptfriedhof möchten wir in einer weiteren Führung am kommenden Totensonntag auf das Thema aufmerksam machen. Dr. Georg Peter Karn, Dr. Karin Kraus und Dr. Luzie Bratner führen zu bemerkenswerten Steine von Mainzer Persönlichkeiten, darunter der Stein des Mainzer Publizisten, Stadtbibliothekars, Revolutionärs, Altertumsforschers und Förderers des Mainzer Gutenberg-Denkmals Friedrich Lehne.
Datum: 23.11.2025 (Totensonntag) und 13.12.2026
Uhrzeit: 15.30 Uhr
Treffpunkt: Hauptfriedhof, Eingang Untere Zahlbacher Straße
Um Anmeldung wird gebeten unter 0157 55977688 oder info(at)mainzer-altertumsverein.de
1.1.1.Römische Steindenkmäler und die Denkmalpflege im späten Mainzer Kurstaat und im französischen Mayence (1784–1814)
Dr. Michael Johannes Klein (Heidelberg)
Die Geschichte der - heute im Landesmuseum - aufbewahrten Sammlung römischer Steindenkmäler aus Mainz reicht bis in das Jahr 1784 zurück. Der Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal erließ in diesem Jahr mehrere Verordnungen zur Denkmalpflege und gründete zugleich ein Münz- und Altertümer-Kabinett an der Mainzer Universität. Als Mainz zu Jahresbeginn 1798 französisch wurde, umfasste die Sammlung bereits mindestens 15 Steindenkmäler. Sie wurde von der französischen Administration 1803 der Stadt Mainz übereignet. Die Ausgrabungen Friedrich Lehnes, insbesondere bei der Anlegung des Hauptfriedhofs, ließen die Sammlung in wenigen Jahren gewaltig anwachsen. Als die Franzosen 1814 abziehen mussten, verfügte das Museum der Stadt Mainz über eine respektable Sammlung von nicht weniger als mindestens 90 römischen Steindenkmälern - einzigartig nördlich der Alpen.
Datum: Montag, 08.01.2024
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz
1.1.2.Von der „Zerstörung der Unschuld“ zur „wahren Freude“. Die Katholische Kirche und die Fastnacht in Mainz zwischen 1925 und 1955
Maylin Amann, M.Ed./M.A. (Mainz)
Auf der Website der Diözese Mainz findet sich unter der Rubrik "Humor" aktuell eine direkte Verlinkung zur Mainzer Fastnacht. Auch die Homepage der Mainzer Fastnacht e.G. verweist auf den katholischen Ursprung des Brauchtums. Die Fastnacht, die als volkstümliche Feierveranstaltung - sieht man von wenigen Ausnahmen ab - alljährlich vor der Fastenzeit stattfindet, wird also wie selbstverständlich als christlich inspiriertes und von der katholischen Kirche akzeptiertes Brauchtum gesehen. Doch: War das wirklich immer so? Gab es schon immer eine solch uneingeschränkte Beziehung und Bejahung zwischen Fastnacht bzw. Karneval und der katholischen Kirche?
Dieser Frage soll am Beispiel Mainz als Fastnachtshochburg und Bischofssitz in den Jahren 1925 bis 1955 nachgegangen werden. Dabei wird vor allem das Verhältnis zwischen Amtskirche und Fastnacht zwischen Weimarer Republik und junger Bundesrepublik näher betrachtet. Unterschiedliche zeitgenössische katholische Quellen zeigen, wie sich die Mainzer katholische Kirche zu öffentlichen Veranstaltungen, Belustigungen und Fastnachtsfeiern im Allgemeinen positionierte. Im Vortrag werden katholische Perspektiven innerhalb der Amtskirche anhand verschiedener Akteure, Medien und Vereinigungen aufgezeigt und analysiert.
Datum: Montag, 05.02.2024
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt-Mainz am Neubrunnenplatz
1.1.3.Die Alumnen des Mainzer Priesterseminars im Zweiten Weltkrieg. Kriegserfahrung und Kriegsdeutung
Dr. theol. Maximilian Künster B. Mus. M. Ed. (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
In den letzten Jahren erlebte der Zweite Weltkrieg eine Hochphase als Forschungsgegenstand der Geschichts- und Sozialwissenschaft. Viele Studien sind erschienen, die die Kriegserfahrung der Soldaten in den Vordergrund rückten. Die Kriegserfahrung und -deutung der am Weltkrieg teilnehmenden katholischen Theologiestudenten und Priester blieb bisher noch größtenteils unberücksichtigt.
Die Erforschung der Feldpostbriefbestände des Mainzer Priesterseminars möchte dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. 867 Feldpostbriefe junger Theologiestudenten und Priester aus den Jahren 1939-1946 geben Auskunft über die spezifische Kriegserfahrung und -deutung einer Gruppe "professioneller Katholiken", die ihre Sozialisation zumeist in einem strengkirchlich geprägten Milieu erhalten hatten. Ihre Wahrnehmung des Krieges wurde durch die am Seminar gelehrte Theologie und das tagtäglich eingeübte Frömmigkeitsideal beeinflusst. Mit der Einberufung in die Wehrmacht waren die Mainzer Seminaristen jedoch spirituell gesehen auf sich allein gestellt. Welche Prägungen und Grundüberzeugungen sich in Bezug auf die Kriegsdeutung der Alumnen, und letztendlich auch in Bezug auf die Bewältigung der Kriegserlebnisse, als wirksam erwiesen haben, möchte der Vortrag herausstellen. Weiterhin möchte er der Frage nachgehen, ob und inwieweit sich die von den Mainzer Seminaristen vertretene Deutung des Krieges signifikant von der anderer Teilnehmergruppen unterscheidet.
Datum: Montag, 11.03.2024
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz
1.1.4.Die Kunsthandlung David Reiling - Eine Spurensuche
Vortrag in Kooperation mit dem Landesmuseum Mainz
Dorothee Glawe, M.A. (Landesmuseum Mainz)
Die seit 1892 von Hermann und Isidor Reiling geführte Kunst- und Antiquitätenhandlung David Reiling war als hessischer, preußischer und russischer Hoflieferant lange die größte und einflussreichste Kunsthandlung in Mainz und überregional sowie international bekannt. 1938 mussten die beiden Brüder aufgrund ihrer jüdischen Abstammung die Kunsthandlung liquidieren. Beide verstarben wenig später, ihre Ehefrauen Hedwig und Flora wurden deportiert. Allein Isidors Tochter Netty Reiling, besser bekannt als Anna Seghers, überlebte den Holocaust in der Emigration. Bis heute gibt es nur wenige Anhaltspunkte dafür, was mit den Kunstwerken aus den Privatsammlungen und dem Kunsthandlungsbestand der Reilings geschah. Diesen Spuren wird im Vortrag nachgegangen, der im Rahmen der Sonderausstellung "Herkunft [un]geklärt" des Landesmuseums Mainz beiträgt.
Datum: Dienstag, 13. August 2024
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Landesmuseum Mainz
1.1.5.Musikvortrag: Pianohaus Müller. 100 Jahre Klaviertradition in Mainz
Prof. Dr. Volker Beeck, Kristina Krämer M. A., Dr. Stefan Riegel Christian Strauss (Klavier), Hannah Sophie Horras (Mezzosopran)
Wilhelm Müller sen. gründete 1845 seine Klaviermanufaktur in Mainz. Zuvor hatte er den Klavierbau in Paris erlernt und Franz Liszt als dessen Klavierstimmer auf Tourneen begleitet. Sein Sohn Wilhelm Müller jun. übernahm die Firma 1883. Er erweiterte das Unternehmen um die Sparten Klavierhandel und -verleih und begründete zahlreiche Filialen. Als Kammermusiker wirkte er 28 Jahre im Orchester des Stadttheaters Mainz mit. Zusätzlich betrieb er einen Musikverlag, in dem vornehmlich eigene Kompositionen herausgegeben wurden. Infolge des Zweiten Weltkriegs kam das Pianohaus in der dritten Generation zum Erliegen.
Die Referentin und der Referent schildern in Kurzvorträgen die spannende Geschichte der Müllers. Dabei werden auch die Ergebnisse neuester Recherchen zu Albert Lortzings Oper „Regina“ präsentiert.
Im Anschluss an den Vortragsteil werden der Pianist Christian Strauss und die Sängerin Hannah Sophie Horras Kompositionen von Wilhelm Müller vortragen.
Datum: Montag, 7. Oktober 2024
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Haus der Gesellschaft Casino "Hof zum Gutenberg" (Casino-Gesellschaft), Große Bleiche 29
1.1.6.Stadtspaziergänge durch Mainz - sechs Jahre unterwegs
Michael Bermeitinger (Allgemeine Zeitung Mainz)
Seit nunmehr sechs Jahren erscheint in der AZ die Serie "Mainzer Stadtspaziergänge" mit bislang rund 280 Folgen. Autor Michael Bermeitinger beschreibt darin Straße für Straße, Platz für Platz die Mainzer Geschichte der vergangenen 150 Jahre. Stadtentwicklung, Architektur, Sozialgeschichte, Wirtschaft und Verkehr spielen eine Rolle, politische und gesellschaftliche Entwicklungen, der Alltag der Menschen, ihre Arbeit und Freizeit. Die Serie, die von einer Podcast-Reihe mit mehr als 60 Ausgaben ergänzt wird, ist auch als Buchreihe mit bislang elf Bänden erschienen. In seinem Bildvortrag erzählt Michael Bermeitinger, wie die Idee zur Serie entstanden ist, welche Quellen er nutzt, woher die vielen tausend Fotos stammen und welches Gewicht diese Art der Berichterstattung für eine lokale Zeitung spielt.
Datum: Donnerstag, 21. November 2024
Uhrzeit: 18.30 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55115 Mainz
1.1.7.Johannes Gutenberg und die Demokratie(-geschichte)
Dr. Kai-Michael Sprenger (Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte)
Die überaus reiche Rezeptionsgeschichte Johannes Gutenbergs steht in einem merkwürdigen Kontrast zu den tatsächlich belegbaren Quellenzeugnissen über den Erfinder und bedeutendsten Mainzer. Immer wieder diente Johannes Gutenberg in späteren Jahrhunderten auch als Projektionsfläche für Aspekte und Forderungen, die Gutenberg selbst wohl kaum verstanden hätte. Besonders seit der Aufklärung wird Gutenberg und seine Erfindung zu einer Symbolfigur etwa für die Pressefreiheit und die Demokratisierung von Bildung und Wissen. Doch auch in anderen thematischen Kontexten wird Gutenberg für die Demokratiegeschichte nutzbar. Der Vortrag fragt nach der Bedeutung und der Funktion Johannes Gutenbergs im Kontext der Demokratiegeschichte und spannt einen weiten Bogen von der Zeit der französischen Revolution und des Vormärz bis in unsere Tage und zum ersten Bürgerentscheid der Mainzerinnen und Mainzer über die Zukunft des Gutenbergmuseums 2018. Ein besonderes Augenmerk gilt der Rolle Gutenbergs bei dem so genannten Demokratenbankett in Mainz am 24. Februar 1849, während das spezifische Gutenberg-Bild in der "Deutschen Demokratischen Republik" ergänzend zeigt, wie Gutenberg auch staatspolitisch vermeintlich demokratisch nutzbar gemacht wurde.
Datum: Montag, 4. November 2024
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz
1.1.8.Mainzer Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg
Lucy Liebe M. A. (GDKE, Direktion Landesdenkmalpflege)
Als die Innenstadt von Mainz im Zweiten Weltkrieg zu einem großen Teil zerstört wurde, waren auch die Kirchen betroffen. Die zuständigen Behörden standen vor einer großen Herausforderung, die sich kaum stemmen ließ. Doch die Mainzer wollten ihre Kirchen im Angesicht von Hoffnungslosigkeit und Identitätsverlust keinesfalls aufgeben. Mit großem Engagement und Einfallsreichtum entstanden Notfallreparaturen, Neuschöpfungen und Nutzungsänderungen, die das Stadtbild bis heute prägen.
Datum: Montag, 2. Dezember 2024
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55116 Mainz
1.2.1.Sonderausstellung „Herkunft [un]geklärt. Die Erwerbungen des Altertumsmuseums und der Gemäldegalerie der Stadt Mainz 1933-1945“
Dorothee Glawe, M.A.
Die Sonderausstellung präsentiert die Ergebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojektes, gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, in dessen Rahmen die Erwerbungen der Gemäldegalerie und des Altertumsmuseums der Stadt Mainz auf ihre Herkunft hin erforscht wurden.
Ziel des Projekts ist es, möglicherweise NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter im Bestand zu identifizieren. Dabei wurden auch grundlegende Erkenntnisse zur Kunststadt Mainz im Nationalsozialismus gewonnen, welche im Rahmen der Ausstellung erstmals umfassend thematisiert werden.
Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos.
Dauer der Führung: ca. 60 Min.
Datum: Dienstag, 23.04.2024
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Landesmuseum Mainz
1.2.2.Sonderausstellungen des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums:
Die ganze Welt auf Pergament - Die spätmittelalterlichen Mainzer Karmeliter-Chorbücher
sowie
Innen! Ansichten Mainzer Kirchen um 1800
(Zeitgleiche Führung durch beide Ausstellungen)
Die Chorbücher aus dem Karmeliterkloster Mainz gehören zu den schönsten Werken der spätgotischen Buchmalerei. In einer exklusiven Führung für die Mitglieder des MAV stellt Ihnen Kuratorin Dr. Anja Lempges die Umstände ihrer Entstehung vor und führt Sie ein in eine von Drachen und anderen Fabelwesen bevölkerte Bilderwelt. Parallel stellt Direktor Dr. Winfried Wilhelmy der zweigeteilten Gruppe in einer weiteren Sonderausstellung bislang unbekannte Darstellungen der wichtigsten Mainzer Kirchen vor und erläutert deren (teils verlorene) Ausstattung.
Datum: Mittwoch, 27. November 2024
Uhrzeit: 17 Uhr
Ort: Dom- und Diözesanmuseum Mainz Kosten: Eintritt 3,50 Euro/Person (inkl. Führung)
1.3.1.SAKRALRÄUME LESEN: Die Doppelchörigkeit des Mainzer Doms
Dr. Felicitas Janson (Akad. Bistum Mainz), Dr. Luzie Bratner, Dr. Georg Peter Karn
In dieser Sonderführung werden die sonst nicht frei zugänglichen Chöre des Mainzer Doms in Architektur, Ausstattung und ihrer Forschungsgeschichte vorgestellt: der so urtümlich romanische Ostchor, der seine heutige Baugestalt den Umbauten aus der Zeit des Bischofs von Ketteler verdankt, mit dem Chorgestühl der Renaissancezeit. Natürlich gilt das Hauptaugenmerk der ungewöhnlichen Baugestalt des westlichen Hauptchores. Seine raumgestaltende Ausstattung mit barockem Chorgestühl und Grabmälern werden Experten und Expertinnen erläutern.
Neben vielerlei Informationen und einem aktualisierten Forschungsstand wird sich Gelegenheit bieten, alte und neue Fragen zu diskutieren.
Termin: Montag, 14. Oktober 2024
Uhrzeit: 16 Uhr
Ort: Mainzer Dom
Treffpunkt: Eingang zum Kreuzgang
1.3.2.Die Mainzer Kartause – Standortbestimmungen
Dr. Joachim Glatz und Dr. Georg Peter Karn
Führung im Rahmen des Begleitprogramms der Sonderausstellung des Dom- und Diözesanmuseums Mainz "'Die unvergleichliche kostbare Carthaus'. Die älteste deutsche Kartause: 700 Jahre Kartäuserkloster Mainz".
Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos.
Dauer der Führung: ca. 90 Min.
Datum: Mittwoch, 28.02.2024
Uhrzeit: 15 Uhr
Treffpunkt: Stadtpark, vor dem Favorite Parkhotel (Parkseite)
1.3.3.Josephskapelle, St. Ignaz und Augustinerkloster
Dr. Joachim Glatz und Dr. Georg Peter Karn
Führung im Rahmen des Begleitprogramms der Sonderausstellung des Dom- und Diözesanmuseums Mainz "'Die unvergleichliche kostbare Carthaus'. Die älteste deutsche Kartause: 700 Jahre Kartäuserkloster Mainz".
Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos.
Dauer der Führung: ca. 90 Min.
Datum: Samstag, 02.03.2024
Uhrzeit: 15.00 Uhr
Treffpunkt: Dom- und Diözsesanmuseum
1.4.Das Schlossviertel als neue Mitte von Mainz
Dr.-Ing. Rainer Metzendorf
Im Wandel des historischen Schlossviertels zum Regierungsviertel der Landeshauptstadt Mainz entstand ab 1950 ein neues städtebauliches Leitkonzept. Ein Ensemble, das sich im Dialog von Alt und Neu als historisch gewachsene Gesamtanlage präsentiert.
Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.
Datum: Freitag, 03.05.2024
Uhrzeit: 15.00 Uhr
Treffpunkt: Jubiläumsbrunnen am Ernst-Ludwig-Platz
„Zur Fortsetzung eines Christlichen Eyffers vnd Gottgefelliger Andacht [seyn] die Teutsche Catholische Kirchengesäng ganz nütz- vnd befoerderlich“. Eine kleine Geschichte der Mainzer Gesangbücher.
Prof. Dr. Ansgar Franz und Dr. Christiane Schäfer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Montag, 16. Januar 2023, 18 Uhr im MVB-Forum am Neubrunnenplatz
Gesangbücher als Gebrauchsgegenstände sind fluide Größen, die sich von Generation zu Generation ändern. In ihnen spiegelt sich die Kultur- und Frömmigkeitsgeschichte der jeweiligen Epochen. In Mainz erschienen bereits im 16. Jahrhundert die ersten (katholischen) Gesangbücher, denen bis in die Gegenwart eine stattliche Anzahl sehr unterschiedlicher Typen folgen sollten: Teils waren sie gegen den Trend der Zeit und trotzdem sehr zählebig, teils nach der neusten literarischen Mode und nur von kurzer Dauer, teils von der Obrigkeit den Gläubigen aufgezwungen, teils von einer bahnbrechenden und weit über die Grenzen des Bistum hinausgehenden Bedeutung, teils rückwärtsgewandt, teils zukunftsorientiert und weitherzig auch für evangelisches Liedgut offen. Der Vortrag will in sieben Schritten die Mainzer Gesangbücher auf dem Hintergrund ihrer historischen, literarischen und liturgischen Kontexte vorstellen.
Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an Veranstaltungen im MVB-Forum an die Durchführung eines negativen Selbsttests/Schnelltests am Veranstaltungstag und an den Eintrag in die Anwesenheitsliste mit den geforderten Daten gebunden ist.
Römische Steindenkmäler aus Mainz - eine Sammlung von herausragendem internationalem Renommee
Dr. Michael Johannes Klein (Heidelberg)
Montag, 13. Februar 2023, 18 Uhr im MVB-Forum am Neubrunnenplatz
Die Sammlung der Mainzer Steindenkmäler wurde bereits vor mehr als 500 Jahren durch die Humanisten Gresemund und Huttich begründet. Einen starken Impuls erhielt die Erforschung der römischen Steindenkmäler aus Mainz durch die Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften im 18. Jahrhundert. Als unmittelbare Folge dieser Aktivitäten beauftragte der Mainzer Kurfürst Emmerich Joseph 1769 den Benediktinerpater Joseph Fuchs, die Geschichte von Mainz zu erforschen. Fuchs ließ zahlreiche Steindenkmäler ausgraben und in den Hof des Schlosses bringen. Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal verfügte in der Verfassung der Universitätsreform von 1784 die Gründung einer archäologischen Sammlung von römischen Altertümern wie Münzen und Steindenkmälern. Seit dem Ende des Kurstaats haben sich die Stadt Mainz und der Mainzer Altertumsverein um die starke Erweiterung und Erforschung dieser Sammlung sehr verdient gemacht. In den letzten Jahrzehnten haben die Johannes Gutenberg-Universität, das Römisch-Germanische Zentralmuseum und das Deutsche Archäologische Institut mit der wissenschaftlichen Bearbeitung und Publikation der Mainzer Steindenkmäler dafür gesorgt, dass diese heute im Landesmuseum Mainz aufbewahrte Sammlung von internationaler Relevanz für jegliche Forschung zu den römischen Anfängen Europas ist.
Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an Veranstaltungen im MVB-Forum an die Durchführung eines negativen Selbsttests/Schnelltests am Veranstaltungstag und an den Eintrag in die Anwesenheitsliste mit den geforderten Daten gebunden ist.
Die Gründung der Deutschen Weinstraße 1935 - Bürckles größte Niederlage im Kampf gegen die Winzernot?
Dr. Christoph Krieger (Mittelmosel-Museum Taben-Trarbach)
Montag, 6. März 2023, 18.00 Uhr im MVB-Forum am Neubrunnenplatz
Nachdem es anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums 1985 zum bundesweiten Eklat kam, gilt es in Politik, Weinbau und Medien der Pfalz allgemein als Konsens, sich gerade auch an Jahrestagen - wie etwa zuletzt dem im September 2016 begangenen 80. Geburtstag des "Deutschen Weintores" in Schweigen - der braunen Vergangenheit der "Deutschen Weinstraße" durchaus zu stellen. "Geniale Idee mit problematischer Herkunft", so hatte ein Journalist in diesem Zusammenhang bereits anlässlich des 75-Jährigen Jubiläums 2010 beispielhaft formuliert. Dass die von den Nationalsozialisten stammende Marketingidee indes zwischenzeitlich "nicht nur nicht unbeschadet überstanden worden ist, sondern äußerst positiv überwunden und weiter entwickelt worden" sei, wie ein Festredner im gleichen Jahr betonte, steht zudem für alle Beteiligten außer Zweifel. Unterschwellig schwang und schwingt dabei stets die Vorstellung mit, dass es lediglich einem dummen Zufall der Geschichte geschuldet sei, warum diese - im Kern ja vorgeblich gänzlich unpolitische - Marketing-erfindung ausgerechnet von einer der schillerndsten Nazigrößen ihre Umsetzung finden musste; ebensogut hätte die Gründung der "Deutschen Weinstraße" auch in den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtergreifung oder nach dem Ende des "Tausendjährigen Reiches" erfolgen können. Genau dies bestreitet der Vortragende. Er hat in seiner 2018 veröffentlichten Dissertation an der Universität Trier die erste umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung der Weinpropaganda im Dritten Reich unternommen und damit erstmals die Möglichkeit eröffnet, insbesondere auch die "geniale Idee" des pfälzischen Gauleiters in einen etwas umfassenderen zeitgenössischen Kontext einzuordnen. Und er hat dabei durchaus überraschende Ergebnisse zutage gefördert!
Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an Veranstaltungen im MVB-Forum an die Durchführung eines negativen Selbsttests/Schnelltests am Veranstaltungstag und an den Eintrag in die Anwesenheitsliste mit den geforderten Daten gebunden ist.
Caroline Böhmer in Mainz: Eine Jakobinerin und die Revolution 1792-1793
Dr. Daniel Meis (Universitäten Bonn / Düsseldorf / Stuttgart)
1763 geboren als Caroline Michaelis in Göttingen, 1784 als Caroline Böhmer nach Clausthal verheiratet, 1796 als Caroline Schlegel und dann Caroline (von) Schelling als Muse der Jenaer Frühromantik bekannt geworden, ging die 1792 28jährige mitsamt Tochter nach Mainz. Dort wurde sie faktisch Teil der Hausgemeinschaft Georg Forsters und erlebte das Ende des alten Kurfürstentums und die Gründung der revolutionären Mainzer Republik mit, bis sie sich 1793 zur Flucht vor den anrückenden Preußen gezwungen sah - dann aber doch noch verhaftet wurde. Wer war also diese Frau, über die heute mehr Legenden als Gewissheiten existieren? Und was genau machte sie eigentlich in Mainz? Der Historiker Daniel Meis führt alltagsnah an Caroline Böhmer und dabei ganz besonders ihre Mainzer Zeit heran.
Termin: Montag, 18. September 2023
Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz
Beginn: 18.00 Uhr
Von Daten zu Fragen und Geschichten - Lexika zur Mainzer Kunst- und Baugeschichte des 18. Jahrhunderts
Prof. Ullrich Hellmann (Mainz-Kastel)
Der Vortrag behandelt Entstehung und Aufbau zweier Lexika zur Mainzer Kunst- und Baugeschichte. Er ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil werden die Lexika zunächst in den Kontext bisheriger Veröffentlichungen gestellt. Es folgen Hinweise zu den Informationsquellen. Anschließend werden Präsentation und Anordnung des Datenmaterials sowie die Auswahl der Berufe erläutert.
Der zweite Teil geht Fragen nach, die sich nach Ermittlung der Daten ergeben, wobei das Bauhand-werk im Zentrum steht. Was bietet die Informationslage zum damaligen Arbeitsleben (Ausbildung, Werkstatt, Arbeitsverträge)? Welche Fakten gibt es zu Verwandtschaften, Freundschaften und kollegialen Beziehungen? Was zeigen die Dokumente über Konflikte im Handwerk? etc.
Im dritten Teil werden auf der Basis des Datenbestandes einige Lebenswege rekonstruiert. Die Biographien sind exemplarisch für Lebens- und Arbeitsbedingungen von Mainzer Künstlern und Handwerkern im 18. Jahrhundert, belegen zugleich aber auch ein Abweichen von Berufskonventionen.
Montag, 16. Oktober 2023
Beginn: 18.00 Uhr
Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz
„Erhabene Natur-Gemählde“ - Friedrich Ludwig Sckell und seine Gärten in Rheinhessen und in der Pfalz
Dr. Georg Peter Karn (Mainz)
Neben seinen berühmten großen Anlagen in Schwetzingen, Aschaffenburg und München schuf Friedrich Ludwig Sckell als Gartenkünstler auch zahlreiche kleinere Gärten, nicht wenige davon im heutigen Rheinland-Pfalz. Die meisten von ihnen fielen schon bald den Revolutionskriegen und Umbrüchen des ausgehenden 18. Jahrhunderts zum Opfer und sind daher heute fast unbekannt. Zu ihnen gehörte auch die Erweiterung der kurfürstlichen Favorite in Mainz durch einen Landschaftsgarten im Bereich des zuvor aufgelösten Kartäuserklosters.
Der Vortrag folgt den Spuren Sckells in Rheinhessen und in der linksrheinischen Pfalz, erinnert an erhaltene wie untergegangene Gärten und geht den familiären sowie personellen Verflechtungen nach, denen der Gartenkünstler seine Aufträge verdankte.
Dienstag, 7. November 2023
Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz
Beginn: ca. 18.30 Uhr (im Anschluss an die Jahresmitgliederversammlung)
Die Entdeckung der Vergangenheit – Die Wiesbadener Sammlung Nassauischer Altertümer und ihre Bedeutung für die Anfänge der Archäologie in Deutschland
Dr. Daniel Burger-Völlmecke (Stadtmuseum Wiesbaden)
Die Sammlung Nassauischer Altertümer (SNA) gehört zu den bedeutendsten archäologisch-historischen Sammlungen Deutschlands, die aus dem Bürgertum heraus entstanden sind. Sie ist untrennbar mit dem 1812 gegründeten Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung verknüpft, der die SNA in den 1820er Jahren als Vergleichs- und Lehrsammlung in Wiesbaden aufbaute. Vom Herzogtum Nassau mit landesarchäologischen Aufgaben betraut, setzte der Verein im Gebiet zwischen Main, Rhein und Westerwald an noch heute bedeutenden Fundstellen erstmals mit wissenschaftlichen Fragestellungen den Spaten an, um dem Boden seine antiken Geheimnisse zu entlocken. Das aus den Grabungen stammende Fundmaterial ging in die SNA ein. Wiesbadener Persönlichkeiten wie Friedrich Gustav Habel, Karl August v. Cohausen und Emil Ritterling setzten mit ihren Forschungen neue Standards und trugen maßgeblich dazu bei, dass der Altertumsverein und die SNA auf dem Gebiet des späteren Deutschlands eine Vorreiterrolle in der Entwicklung der Archäologie hin zu einer wissenschaftlichen Disziplin einnahmen.
Der Vortrag stellt heraus, welche Bedeutung die Forschungen des Nassauischen Altertumsvereins und mit ihm die SNA für die noch junge Archäologie im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatten und welche wichtigen Impulse aus Wiesbaden die archäologischen Forschungen in Deutschland beeinflussten.
Montag, 4. Dezember 2023
Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz
Beginn: 18.00 Uhr
Sonderausstellung „Der Mainzer Domschatz – Meisterwerke aus 1000 Jahren“
Dr. Winfried Wilhelmy
Mittwoch, 8. Februar 2023, 17.00 Uhr im Dom- und Diözesanmuseum Mainz
Einst war er einer der größten Kirchenschätze des Abendlandes - der Mainzer Domschatz. Doch 1803 wurde er aus Furcht vor den Franzosen fast völlig eingeschmolzen. Die Sonderausstellung spürt nicht nur der wechselvollen Geschichte dieses alten Domschatzes nach; sie stellt auf 400 qm auch die schönsten Goldschmiedearbeiten des neuen, seither zusammengetragenen Bestandes an liturgischem Gerät vor. Im Fokus der Kuratorenführung stehen dabei die Werke der wichtigsten Mainzer Goldschmiede - nicht nur - für den Dom. Die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins erhalten eine exklusive Führung durch diese Sonderausstellung des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz von dessen Direktor Herrn Dr. Winfried Wilhelmy.
Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an der Führung nur nach erfolgter Anmeldung (info@mainzer-altertumsverein.de) möglich ist.
„Aurea Magontia – Mainz im Mittelalter“
Dr. Birgit Heide
Dienstag, 28. Februar 2023, 18 Uhr im Landesmuseum Mainz
Die Ausstellung gibt einen Überblick über mehr als 800 Jahre Mainzer Stadtgeschichte. Sie führt vom frühen Mittelalter, als für Mainz ein neuer wirtschaftlicher und politischer Aufstieg einsetzt, über das „Goldene Mainz“ bis hin zur freien Stadt und der Errichtung des Kaufhauses am Brand durch die Mainzer Bürger am Beginn des 14. Jahrhunderts.
Frau Dr. Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums und Mitglied des MAV-Beirats, wird die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins persönlich durch die Ausstellung führen, die aus den Sammlungen des Landesmuseums, ergänzt mit Leihgaben aus dem Stadtarchiv Mainz, dem Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Mainz, der Landesarchäologie (Außenstelle Mainz) und dem Stadtmuseum Wiesbaden erstellt wurde.
Landesmuseum Mainz: "Ein barockes Mainzer Möbel enthüllt seine Geheimnisse – das Meisterstück von Peter Schuss von 1763"
Gernot Frankhäuser
Dienstag, 21. März 2023, 18.00 Uhr im Landesmuseum Mainz
1990 konnte das Landesmuseum auf dem us-amerikanischen Auktionsmarkt ein in Mainz gefertigtes Prunkmöbel erwerben. Gemäß den Vorschriften der Schreinerzunft birgt das „Cantourgen“ Überraschungen, die nur bei Öffnung der Türen zu entdecken sind. Geführt von unserem Beiratsmitglied Herrn Gernot Frankhäuser wird den Mitgliedern des MAV dieses exklusive Erlebnis geboten. Gegenübergestellt wird ein Verwandlungsmöbel aus der Neuwieder Manufaktur von Abraham und David Roentgen von 1768.
Anmeldung bitte per E-Mail an: info@mainzer-altertumsverein.de
Sonderausstellung: „Die unvergleichliche kostbare Carthaus“ Die älteste deutsche Kartause: 700 Jahre Kartäuserkloster Mainz
Dr. Gerhard Kölsch
Als "unvergleichliche kostbare Carthaus" priesen Reiseberichte des 18. Jahrhunderts das Mainzer Kartäuser-Kloster, dessen Besichtigung damals zu den Höhepunkten einer jeden Rheinreise gehörte. Doch 1781 wurde das Kloster säkularisiert und dem Abriss preisgegeben. Die Sonderausstellung stellt Geschichte und Glanz der ältesten deutschen Kartause vor.
Dienstag, 21. November 2023
Beginn: 16.30 Uhr (Dauer ca. 60 Min)
Ort: Dom- und Diözesanmuseum Mainz
Anmeldung bis 13.11.2023 an: Birgit.Kita(at)Bistum-Mainz.de oder Tel. 06131 / 253 344.
Die Führung ist für Mitglieder des MAV kostenlos". Bitte weisen Sie bei der Anmeldung auf die Mitgliedschaft hin.
Die Mainzer Kartause - Standortbestimmungen
Dr. Joachim Glatz und Dr. Georg Peter Karn
Die alten Dimensionen des ehemaligen Klosterareals werden gemeinsam abgeschritten. So wird eine Standortbestimmung möglich.
Montag, 13. September 2023
Treffpunkt: Stadtpark, vor dem Favorite Parkhotel
Beginn: 15 Uhr (Dauer ca. 90 Min)
Josephskapelle, St. Ignaz und Augustinerkloster
Dr. Joachim Glatz und Dr. Peter Karn
Der zweite Spaziergang beschäftigt sich mit den Überresten der ehemaligen Ausstattung des Kloster, die, verteilt auf andere Standorte in Mainz, bis heute überdauert haben.
Samstag, 23. September 2023
Beginn: 15 Uhr (Dauer ca. 90 Min)
Treffpunkt: Dommuseum
Die Altäre der ehem. Kartäuserkirche (heute Seligenstadt) und die Kartause Tückelhausen
Dr. Peter Karn und Dr. Joachim Glatz
Exkursion in Kooperation des Dom- und Diözesanmuseums, des Mainzer Altertumsvereins und der Akademie des Bistums Mainz, Erbacher Hof
Die Kirche der ehemaligen Mainzer Kartause war vor allem im 18. Jahrhundert noch einmal auf das kostbarste mit Altären, Skulpturen, Bildern und Altargerät geschmückt worden. Nach der Auflösung und dem Abbruch des Klosters 1781 ging manches verloren, doch wurden bedeutende Teile der Ausstattung versteigert und auf andere Kirchen verteilt, wo sie sich bis heute erhalten haben. So sind drei der ursprünglich fünf großen Marmoraltäre in die ehemalige Benediktinerkirche St. Marcellinus und Petrus in Seligenstadt gekommen. Die in der Ausstellung als große Leuchtbilder zu bestaunenden Altäre werden wir auf der Exkursion besuchen und ausführlich besprechen. Aber auch die ehemalige Klosterprälatur in Seligenstadt mit den barocken Innenräumen und dem rekonstruierten Garten soll in einem kurzen Rundgang besichtigt werden. Nach dem Mittagessen in Seligenstadt (individuell) fahren wir nach Tückelhausen. In der Kartause Cella Salutis, 1351 gegründet und 1803 im Rahmen der Säkularisation aufgehoben, unterhält die Diözese Würzburg ihr Kartäusermuseum Tückelhausen. Erhalten hat sich die Gesamtanlage mit der reich ausgestatteten Kirche und einem Großteil der barocken Klostergebäude. Im Kreuzgang und in zwei ehemaligen Zellen wird die Geschichte und Spiritualität des Kartäuserordens sowie das Leben eines Kartäusermönches vermittelt.
Termin: 21. Oktober 2023
Abfahrt: 8:30 Uhr am Hauptbahnhof (Nordsperre)
Dauer: Ankunft zurück in Mainz gegen 19:00 Uhr
Kosten: 45,- € pro Person
Anmeldung: Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen bei: Birgit.Kita@Bistum-Mainz.de oder Tel. 06131 / 253 344.
Für den Fall, dass nicht genügend Anmeldungen eingehen sollten, um die Exkursion kostendeckend anbieten zu können, behalten wir uns vor, die Fahrt abzusagen. Sie erhalten in diesem Fall die von Ihnen bereits entrichtete Teilnahmegebühr zurückerstattet.
Bitte beachten Sie, dass wir bei einem nach dem 22.09.2023 erfolgten Rücktritt 20,- € pro Person als Kostendeckungsbeitrag einbehalten müssen.
"nuhr von grose und sehr reiche herren". Maximilian von Welsch. Ein Architekt und Gartenplaner
Dr. Georg Peter Karn (Mainz)
Am 08.02.2022 wird Dr. Georg Peter Karn über den Architekten und Gartenplaner Maximilian von Welsch referieren. Maximilian von Welsch, der 2021 seinen 350. Geburtstag hatte, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Architekten des 18. Jahrhunderts. Unter dem Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn (1655-1729) entstanden nach seiner Regie und Planung unter anderem die Mainzer Favorite oder die Orangerie in Fulda.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Akademie Erbacher Hof des Bistums Mainz und dem Mainzer Altertumsvereins e.V.
Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich. Näheres entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungsflyer.
Die Überwindung von Zweifeln führt zum wahren Glauben – Anton Maulbertschs Bild der „Himmelfahrt Mariens“ vom Hochaltar des Altmünsters in Mainz
Prof. Dr. Hubertus Günther (München)
Montag, 17. Oktober 2022, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Der Vortrag behandelt das Bild des großen Wiener Barock-Malers Anton Maulbertsch, das jetzt an der Westwand von St. Quintin in Mainz hängt, im Zusammenhang mit dem Altmünster, für das es ursprünglich bestimmt war. Auf den ersten Blick wirkt es ebenso offensichtlich wie die vielen barocken Altarbilder des gleichen Sujets. Aber bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass es sich wesentlich von den üblichen Darstellungen unterscheidet und eine sehr individuelle Bedeutung hat. Es erweist sich, dass sein Inhalt mit der kostbaren Reliquie des Schweißtuchs Christi verbunden ist, die einst dem Altmünster-Kloster gehörte und jetzt im Mainzer Dom aufbewahrt wird. Gezeigt wird, dass die Darstellung vom Geist der Aufklärung beeinflusst ist. Es scheint, dass sich das Kloster mit der neuen Ausstattung seiner Kirche um die Mitte des 18. Jahrhunderts gegen die Auswirkungen der Säkularisation zu wehren versucht hat, die schließlich zu seinem Untergang führten sollte.
Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das ausgedruckte Anmeldeformular oder per Mail an info@mainzer-altertumsverein.de.
Balduin von Luxemburg – Administrator des Erzbistums Mainz. Eine neue Sicht auf die Mainzer Kurfürstenreliefs
PD Dr. Eduard Sebald (Mainz)
Montag, 5. Dezember 2022, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Zu den bekanntesten Stücken des Landesmuseums Mainz gehören die Bildwerke des ehemaligen Mainzer Kaufhauses: die sogenannte Kaufhausmadonna sowie die Reliefs Kaiser Ludwigs IV., d. Bayern, der sieben Kurfürsten und des hl. Martin. Das um 1311/17 errichtete Kaufhaus, eine städtische Einrichtung, in der u.a. zu verzollende Waren gestapelt wurden, wurde 1793 – beim Bombardement der altehrwürdigen Kurfürstenresidenz Mainz – schwer beschädigt und 1812/13 abgetragen. Hingegen blieben die Skulptur und die Reliefs erhalten und wurden bereits im darauffolgenden Jahr der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ikonographie des Dargestellten galt als weitgehend erforscht. Bisher unbeachtet blieb freilich ein Detail: Auf der Schulter des Mainzer Kurfürsten, der unmittelbar neben dem deutschen Regenten dargestellt ist, ist wahrscheinlich ein bekrönter Löwe mit Mainzer Rad skulptiert. Die Kombination beider Wappen ist ein Hinweis auf Balduin von Luxemburg, der zwischen 1328 und 1337 als Administrator des Erzbistums Mainz fungierte. Die Beobachtung legt eine vollkommen neue Deutung der Reliefs nahe, die auch deren umstrittene Datierung klärt. Mit dem Vortrag wird die These erstmals der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.
Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das ausgedruckte Anmeldeformular oder per E-Mail an: info@mainzer-altertumsverein.de.
Maximilian von Welsch – zum Berufsbild eines Architekten im 18. Jahrhundert
Gernot Frankhäuser (Landesmuseum Mainz)
Montag, 7. November 2022, 19.00 Uhr im Haus am Dom, Liebfrauenplatz 8
Maximilian (von) Welsch kam als Militäringenieur nach Mainz und starb 1745 als einer der bedeutenden Architekten des „mainischfränkischen“ Barock. Sein wichtigster Auftraggeber, Kurfürst Lothar Franz von Schönborn, griff nicht nur selbst in die Planungen mit ein, sondern versammelte meist adlige Berater („Kavaliersarchitekten“) um sich. Der Vortrag stellt einige Baudenkmäler vor, die aus diesem Kreis hervorgingen und wirft einen Blick auf den „Dilettantismus“ in den Künsten und das Berufsbild des Architekten im 18. Jahrhundert.
Der Vortrag ist Teil der Architekturreihe der Akademie des Bistums Mainz, Erbacher Hof.
Anmeldung bitte über die Seite des Erbacher Hofes.
„Wahre Bildnuß der Statt Maintz“ – Historische Ansichten als Quelle für die Denkmalpflege
Dr. Georg Peter Karn (Mainz)
Dienstag, 22. November 2022, ca. 19.00 Uhr im Landesmuseum Mainz
(im Anschluss an die Jahresmitgliederversammlung)
Historische Ansichten werden geschätzt als künstlerische Werke der Malerei oder Graphik, sie gelten jedoch auch als beredte Quellen vergangener Jahrhunderte. Bauhistoriker und Denkmalpfleger können aus ihnen wichtige Informationen über mitunter längst untergegangene oder vielfach veränderte Gebäude gewinnen, die sich zum Teil auch für Restaurierungsmaßnahmen auswerten lassen. In freier Abwandlung der Überschrift von Matthäus Merians berühmter Stadtansicht aus dem Jahre 1633 ist jedoch die Frage zu stellen: Wie wahr sind eigentlich die Bildnisse der Stadt Mainz? Wie zuverlässig sind ihre Aussagen über den historischen Zustand von Bauten, Straßen und Plätzen? Der Vortrag geht diesen Fragen nach und stellt unterschiedliche Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem historischen Bildmaterial vor, darunter den Schönborner Hof an der Schillerstraße mit seinen nach dem Zweiten Weltkrieg rekonstruierten Giebelaufsätzen. Ein eigener Abschnitt ist den Erkenntnissen gewidmet, die sich für das farbige Erscheinungsbild historischer Fassaden, wie etwa am kürzlich sanierten Deutschhaus, ableiten lassen.
Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das ausgedruckte Anmeldeformular oder per E-Mail an info@mainzer-altertumsverein.de.
Sonderausstellung „Aurea Magontia – Mainz im Mittelalter“
Dr. Birgit Heide
Dienstag, 11. Oktober 2022, 18.00 Uhr im Landesmuseum Mainz
Die Ausstellung gibt einen Überblick über mehr als 800 Jahre Mainzer Stadtgeschichte. Sie führt vom frühen Mittelalter, als für Mainz ein neuer wirtschaftlicher und politischer Aufstieg einsetzt, über das „Goldene Mainz“ bis hin zur freien Stadt und der Errichtung des Kaufhauses am Brand durch die Mainzer Bürger am Beginn des 14. Jahrhunderts.
Frau Dr. Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums und Mitglied des MAV-Beirats, wird die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins persönlich durch die Ausstellung führen, die aus den Sammlungen des Landesmuseums, ergänzt mit Leihgaben aus dem Stadtarchiv Mainz, dem Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Mainz, der Landesarchäologie (Außenstelle Mainz) und dem Stadtmuseum Wiesbaden erstellt wurde.
Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das Anmeldeformular oder per E-Mail an: info@mainzer-altertumsverein.de.
Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in Trier
Samstag, 29. Oktober 2022
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz veranstaltet in diesem Jahr die große Sonderausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“, eines einst mächtigen Reiches, das zahlreiche Länder des heutigen Europas, Nordafrikas sowie des Nahen Ostens umfasste. Warum ist dieses riesige Reich nach mehreren Jahrhunderten seiner Existenz schließlich im 5. Jahrhundert n. Chr., soweit seine westliche Hälfte betroffen ist, zugrunde gegangen? Bei einer Führung durch diese Sonderausstellung im Rheinischen Landesmuseum werden wir am Nachmittag des 29. Oktober die Antwort(en) auf diese Frage ausführlich erläutert bekommen.
Bereits vor der Mittagspause in einem renommierten Restaurant in der Trierer Fußgängerzone werden wir im Museum am Dom bei einer Führung durch die Ausstellung „Im Zeichen des Kreuzes – Eine Welt ordnet sich neu“ erfahren, wie die neue – anfangs verfolgte – Religion des Christentums durch das römische Kaisertum im 4. Jahrhundert n. Chr. zunächst gefördert und schließlich zur (alleinigen) Staatsreligion erklärt wurde und somit die Grundlagen für die weitere christliche Entwicklung des Abendlandes gelegt wurden.
Zusätzliche Eindrücke zur Geschichte von Trier erhalten wir durch den Reiseleiter auf einem Spaziergang entlang des römischen Stadttors Porta Nigra, des Petrusbrunnens auf dem Hauptmarkt, der Domkirche St. Peter (mit spätrömischem Kernbau) sowie der spätrömischen Palastaula (allgemein unter der Bezeichnung Basilika“ bekannt) und des kurfürstlichen Schlosses. Der Reiseleiter, Dr. Michael J. Klein, Hauptkustos i.R. (Landesmuseum Mainz) und Beirat im Mainzer Altertumsverein, freut sich darauf, Sie, liebe Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins, in seine Heimatstadt zu begleiten.
Bei eventuellen Fragen zur Trier-Reise wenden Sie sich bitte an den Reiseleiter: Tel. 0176 / 73 68 33 07; E-Mail: michael.johannes.klein@outlook.de.
Termin: Samstag, 29. Oktober 2022
Abfahrt: Samstag, 29. Oktober 2022, 7:45 Uhr, Mainz Hauptbahnhof, Nordsperre
Leistungen Komfortabler Reisebus, Sämtliche Führungen und Eintritte
Bitte beachten Sie, dass die Zahl der Teilnehmer/-innen auf 25 Personen begrenzt ist.
Preis für MAV-Mitglieder € 70,- und für Gäste € 75,-
Wenn Sie mitfahren möchten, melden Sie sich bitte mit dem ausgedruckten Anmeldeformular an und überweisen Sie den Reisepreis unter Angabe des Reiseziels „Trier“, Ihres Vor- und Zunamens und Ihrer Telefonnummer auf das Exkursionskonto des Altertumsvereins bei der MVB, IBAN: DE71 5519 0000 0022 0990 22, BIC: MVBMDE55.
Bei Rücktritt nach dem 30.09.2022 behalten wir € 30,- p. P. als Kostendeckungsbeitrag ein.
Aufgrund der Kontakteinschränkungen während der Corona-Pandemie fanden im Frühjahr 2021 keine Veranstaltungen statt.
Sonderausstellung "Hexenküche - Max Slevogts druckgrafische Experimente" im Landesmuseum Mainz
In Kooperation mit dem Landesmuseum laden wir Sie herzlich zu exklusiven Führungen für die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins durch die aktuelle Max Slevogt-Ausstellung ein.
Folgende Termine stehen zur Auswahl (Treffpunkt ist jeweils das Foyer des Landesmuseums):
10. November 2021, 17.00 Uhr
24. November 2021, 17.00 Uhr
8. Dezember 2021, 17.00 Uhr
Falls Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich bitte unter Angabe des von Ihnen bevorzugten Termins bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Datum unter der E-Mail-Adresse info(at)mainzer-altertumsverein.de an. Sofern Sie eine Begleitperson mitbringen möchten, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung mit an. Ohne vorherige Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf max. zehn Personen pro Führung beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des E-Mail-Eingangs bearbeitet. Für den Fall, dass Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann, senden wir Ihnen eine Absage per E-Mail.
Bitte beachten Sie, dass für die Veranstaltung die 3-G-Regel gilt, d. h. eine Teilnahme ist nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene möglich (Einlass nur mit entsprechendem Nachweis)!
Informationen zur Ausstellung:
Glasätzungen mit der hochgiftigen Flusssäure, Drucke auf Leder und Seide, Druckplatten aus Porzellan oder Speckstein – das sind die Ergebnisse zahlreicher Nächte, in welchen Max Slevogt eifrig mit druckgrafischen Techniken experimentierte. Gemeinsam mit den Künstlern Bernhard Pankok und Emil Orlik sowie seinem engen Freund Dr. Josef Grünberg, schloss sich dieser um 1920 zu der Künstlergruppe „SPOG“ zusammen, die nach ihren Anfangsbuchstaben benannt wurde.
In dieser Ausstellung wird erstmals der umfangreiche und bisher unveröffentlichte Briefwechsel zwischen Slevogt und Grünberg transkribiert, wissenschaftlich bearbeitet und in einer kommentierten Briefedition veröffentlicht. Der erste Brief wurde genau vor 100 Jahren geschrieben. Fast alle der Briefe und Postkarten, sind zudem mit aufwendigen und humorvollen Randzeichnungen von Slevogt versehen. Neben vielen privaten und politischen Ereignissen stehen in dem Austausch vor allem die druckgrafischen Experimente der beiden im Vordergrund.
Die Ausstellung arbeitet erstmals diese höchst produktive Zusammenarbeit auf, veröffentlicht die Korrespondenz und rekonstruiert die Experimente ihrer sog. „Hexenküche“.
(Weitere Hinweise zur Ausstellung unter https://landesmuseum-mainz.de/de/ausstellungen/hexenkueche/ .)
„Kurfürst und Bürgerschaft. Transformationen des Mainzer Schlosses“ am 29./30. Oktober 2021 im Kurfürstlichen Schloss, Mainz
Dem Mainzer Schloss ist zweifellos der Rang des bedeutendsten Profangebäudes der Stadt und Rheinhessens zuschreiben. Eine Stimme mag die aktuelle Wahrnehmung des Gebäudes und seiner wechselvollen Geschichte exemplarisch illustrieren. Mit Blick auf den 1628 begonnenen Schlossbau berichtete am 18.10.2019 die Hochheimer Zeitung: „Als Herrschersitz diente es Kurfürsten und Erzbischöfen bis zum Untergang des Kurfürstentums Anfang des 19. Jahrhunderts, danach als Kaserne, Lazarett und Zollmagazin.“ Den Kern des Schlosses stellt die seit den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts nach dem Verlust der Mainzer Stadtfreiheit 1462 errichtete Martinsburg dar. Burg und Schloss wurden zum Herrschaftsinstrument und Machtsymbol gegen die Mainzer Bürgerschaft und ihre seit dem hohen Mittelalter erkämpften Freiheitsrechte, später zum Schwerpunkt der blühenden barocken Residenzstadt.
Mit dem 1792/93 im kurfürstlichen Akademiesaal tagenden Jakobinerclub beginnt eine neue Transformationsphase des Mainzer Schlosses, die immerhin über zweihundert Jahre umfasst und bisher wenig im Zentrum des Interesses stand. Vor allem gilt es, über die Nutzung von Areal und Gebäuden als Zollmagazin, Lazarett und Kaserne die vielfältigen Verwendungen durch bürgerliche Gesellschaften und Einrichtungen vor allem seit den 1840er Jahren stärker in den Fokus zu rücken.
Das Mainzer Schloss wurde bis hin zum Millionenspektakel der Mainzer Fastnacht immer mehr zu einem Haus des Mainzer Kulturlebens. Bei der bevorstehenden Sanierung des Gebäudes kommt es darauf an, diesen Aspekt zusammen mit den architekturgeschichtlichen und denkmalpflegerischen Anliegen angemessen zu berücksichtigen. Auch als Kongresszentrum sollte das Schloss als ein Haus der Mainzer Bürger wahrgenommen werden. Dazu könnten Räume dienen, in denen die entsprechenden Aspekte der Mainzer und rheinhessischen Geschichte angesprochen werden.
Auf der Tagung sollen deshalb neben den historischen, architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Aspekten die verschiedenen Museen und kulturellen Ereignisse im Vordergrund stehen, die sich seit dem 19. Jahrhundert bis zur derzeitigen Nutzung als Kultur- und Kongresszentrum mit dem Schloss verbinden (Einladung und Programm).
Die gemeinsame Tagung des IGL, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), des Mainzer Altertumsvereins (MAV) sowie der Landeshauptstadt Mainz wird geleitet vom ehem. IGL-Direktor Prof. Dr. Michael Matheus und Dr. Georg Peter Karn (GDKE und MAV).
"Residenzstädte in der Transformation" des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung vom 12.11.2021 bis zum 14.11.2021
Sehr geehrte Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins e.V., sehr geehrte Interessenten,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die diesjährige Tagung des SWAK vom 12.11. bis zum 14.11. mit dem Thema "Residenzstädte in der Transformation" live per Zoom übertragen wird. Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen. Um teilnehmen zu können, nutzen Sie bitte die folgenden Links:
Freitag: https://us02web.zoom.us/j/85498074558?pwd=djhxUzN6MUxCS0FBQjFleHYyZjhyQT09
Samstag: https://us02web.zoom.us/j/84340248906?pwd=VmxpT2Z0ejlqenl1eENaZ1NhOGxnUT09
Sonntag: https://us02web.zoom.us/j/85973030811?pwd=Y1BrMzZFdG56Nk1Ec1J1OHhVbGdzZz09
Meeting-ID: 854 9807 4558
Kenncode: 102892
Das Tagungsprogramm finden Sie hier.
Aufgrund der Kontakteinschränkungen während der Corona-Pandemie fanden 2020 nur eingeschränkt Veranstaltungen statt.
Die kurfürstlich-mainzische Hofmusik aus der Sicht eines Archivalienneufundes in Breslau, der Handakten der beiden Hofmusikintendanten Graf Ingelheim und Graf Hatzfeld
Dr. Franz Stephan PELGEN (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Montag, 20. Januar 2020, 18 Uhr im MVB-Forum
Die kurfürstlich-mainzische Hofmusik aus der Sicht eines Archivalienneufundes in Breslau, der Handakten der beiden Hofmusikintendanten Graf Ingelheim und Graf Hatzfeld
Unser früheres Vorstands- und jetziges Beiratsmitglied Dr. Stephan Pelgen hat schon des Öfteren ein „Näschen“ für relevante Quellenneufunde zur kurmainzischen Kulturgeschichte bewiesen und möchte auf der Basis einer solchen Entdeckung einen Blick in die Organisationsebene der Mainzer Hofmusik zum Ende des 18. Jahrhunderts werfen. Im Herrschaftsarchiv der in Niederschlesien ge-legenen, früher gräflich/fürstlich-hatzfeldischen Besitzungen Trachenberg (Żmigród), liegen (heute im Staatsarchiv Breslau) die Handakten des letzten Mainzer Hofmusikintendanten Franz Ludwig von Hatzfeld, und in ihnen diejenigen seines Vorgängers Carl Philipp von Ingelheim. Das war der Forschung bislang ganz unbekannt, und diese Akten sind ein wahrer Schatz! Auch eine noch unbekannte Mozart-Handschrift aus Mainz ist enthalten.
Mainzer Hofsänger anno 1789: Akademien im Mainzer Schloss unter Kurfürst Friedrich Carl Joseph von Erthal
Prof. Dr. Karl BÖHMER, Villa Musica Mainz / Hochschule für Musik Mainz
Montag, 17. Februar 2020, 18 Uhr im MVB Forum
Lange bevor im Akademiesaal des Mainzer Schlosses die Mutter aller TV-Fastnachtssitzungen einzog, wurde dort meisterhaft gesungen – frei nach dem Motto „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Denn der letzte in Mainz residierende Kurfürst Friedrich Carl Joseph von Erthal ließ den „Festinsaal“ des Schlosses 1786 von dem Franzosen Antoine-François Peyre als klassizistischen Konzertsaal mit umlaufender Galerie umgestalten. Dort fanden die glanzvollen Akademien der Mainzer Hofkapelle statt, und die Arien der Hofsänger hatten in den Programmen ihren festen Platz. Besonders der „erste Hofsänger“ Francesco Ceccarelli, Sopran-Kastrat aus Italien und ein Freund Mozarts, setzte mit großen Arien im Stil der Opera seria Akzente. Auch die legendäre Primadonna Luísa Todi gastierte Anfang März 1789 zu drei Konzerten in Mainz. Hortensia Gräfin Hatzfeld, die Schwägerin des Mainzer Hofmusikintendanten, glänzte in Arien aus Mozarts Idomeneo. Im Oktober 1790 kam schließlich Mozart selbst in den Akademiesaal, um mit Ceccarelli und der Hofkapelle zu konzertieren.
Prof. Dr. Karl Böhmer, wissenschaftlicher Direktor der Landesstiftung Villa Musica und Honorar-Professor an der Musikhochschule Mainz, gibt in seinem Vortrag Einblicke (und Hörproben!) in die Sinfoniekonzerte der Erthalzeit, in ihre Programme und besonders in die glanzvollen Auftritte der damaligen Mainzer Hofsänger.
Eine schwierige Liaison - Klöster und Festungen in Kurmainz (ausgefallen wegen Corona)
Montag, 16. März 2020, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Dr. Georg Peter KARN (Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege)
Zu den ersten Maßnahmen und zugleich zu den ehrgeizigsten Projekten, die der Mainzer Kurfürst und Würzburger Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn während seiner Regierung nach dem 30jährigen Krieg einleitete, gehörte die Neubefestigung der wichtigsten Städte seiner Territorien. Mainz, Würzburg und Erfurt zählten bald zu den stärksten Festungen des Reiches. Betroffen von den ausgreifenden Baumaßnahmen waren in besonderem Maße die traditionsreichen Klöster und Stifte, die am Rande oder außerhalb der Städte lagen und oftmals durch ihre exponierte Lage strategisch wichtige Punkte besetzten, wie das Mainzer Jakobskloster und die Abtei Petersberg in Erfurt. Trotz der geistlichen Landesherrschaft hatten sie sich sicherheitspolitischen Interessen unterzuord-nen. Eingeschlossen von Festungsmauern waren die Mönche gezwungen, erhebliche Einschränkun-gen sowie Besitzverluste hinzunehmen und sich mit dem rauen Garnisonsleben zu arrangieren. Andere Konvente wie das Mainzer Altmünsterkloster mussten sogar den gewaltigen Befestigungswerken weichen und konnten nur mit Mühe ihre Existenz retten. Wenigen – wie Stift Haug in Würzburg und St. Peter in Mainz – gelang es dagegen, den Untergang ihrer mittelalterlichen Kirchenge-bäude und den drohenden Verlust ihrer geschichtlichen Identität für einen kreativen Schub zu nutzen und im Spannungsfeld zwischen Traditionsbindung und Neuanfang glanzvolle Neubauten zu errichten.
Bitte beachten Sie: Der Vortrag wird wegen der aktuellen Diskussion um die Ansteckungsgefahr durch das Coronaviurs auf unbestimmte Zeit verschoben!
Führung durch die Sonderausstellung "bauhaus - form und reform. von der reformbewegung des kunstgewerbes zum wohnen mit ikonen"
Samstag, 4. Januar 2020, 14.00-15.00 Uhr, Landesmuseum Mainz
Das 1919 gegründete Bauhaus fiel nicht vom Himmel, sondern hatte Vorläufer und nahm viele Anregungen und Errungenschaften des 19. Jahrhunderts auf und entwickelte sie weiter. Unser Beiratsmitglied Gernot Frankhäuser, der die Sonderausstellung mit konzipiert hat, legt bei der Führung durch die Ausstellung den Schwerpunkt auf Kunsthandwerk und Industrie aus Mainz bzw. dem heutigen Rheinland-Pfalz.
Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist. Eine Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung an info@mainzer-altertumsverein.de oder unter Tel. 06131 / 22 94 42 möglich. Die Teilnahme ist für Mitglieder des MAV kostenlos.
Führung durch die Sonderausstellung "Egon Hartmann und der Wiederaufbau von Mainz"
Samstag, 15. Februar 2020, 14.00 Uhr, Landesmuseum Mainz
Egon Hartmann (1909-2009) war eine Schlüsselperson für den Städtebau der Nachkriegszeit in Deutschland. Durch seine beruflichen Stationen in Weimar, Erfurt, Berlin, Mainz und München hat er sowohl im Osten als auch im Westen beim Wiederaufbau zerstörter Städte Maßstäbe gesetzt. Von 1954 bis 1959 arbeitete Hartmann im Baudezernat der Stadt Mainz und fertigte 1955, zehn Jahre nach Kriegsende, den ersten zusammenhängenden Rahmenplan für die Mainzer Innenstadt - Grundlage für den späteren Wiederaufbauplan von Ernst May. Anlässlich Hartmanns 100. Geburtstags belegen Ausstellungen in Erfurt, Berlin und München sein umfangreiches Wirken. Das Landesmuseum präsentiert Hartmanns städtebauliche und architektonische Planungen für Mainz mit Beständen aus den Architekturmuseen in Berlin und München, sowie aus dem Mainzer Stadtarchiv.
Durch die Ausstellung führt der Mitkurator der Ausstellung Dr.-Ing. Rainer Metzendorf, Architekt und Stadtplaner dwb, Mainz.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist für Mitglieder des MAV kostenlos.
„Intoleranz und Religions-Einschränkung“? Katholiken, Lutheraner und Reformierte in Worms im 18. Jahrhundert
Carolin Katzer, M.Ed. (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Montag, 9. Dezember 2019, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Die Begriffe „Intoleranz“ und „Religions-Einschränkung“ erinnern an die konfessionelle Aufladung von Konflikten im Zeitalter der Reformation. Doch ganz im Gegenteil beschwerten sich die Katholiken über Intoleranz im 18. Jahrhundert, insbesondere über Religionseinschränkungen des lutherischen Magistrats in der Reichsstadt Worms. Dies steht im Gegensatz zu der Annahme, dass der Westfälische Frieden von 1648 den religiösen Frieden im Reich dauerhaft sichern konnte. Erst in den letzten Jahrzehnten konnte herausgestellt werden, dass die konfessionellen Spannungen lediglich konserviert wurden und im 18. Jahrhundert mit erneuter Macht aufbrachen.
Kaum beachtet sind bisher jedoch die Konfessionskonflikte in der Reichsstadt Worms im Zeitalter der Aufklärung. In Worms zeigten sich die Fronten in konfessionellen Konflikten noch im 18. Jahrhundert verhärtet, da Religionsbeschwerden meist durch emotionale Faktoren wie Erniedrigung oder Kränkung ausgelöst wurden. Konfessionelle Konflikte, zum Beispiel Streitigkeiten um katholische Prozessionen oder Kämpfe um die Nutzung von Kirchen, existierten ebenso in Worms wie die Bereitschaft der Gläubigen, in Mischehen ein friedliches multikonfessionelles Leben pragmatisch zu gestalten. Der Vortrag nimmt diese Vielfalt des konfessionellen Mit- und Gegeneinanders in den Blick, um ein differenziertes Bild des multikonfessionellen Zusammenlebens in der Reichsstadt Worms im 18. Jahrhundert aufzuzeigen.
Ein Blick hinter die Kulissen – Quellenbasierte digitale 3D-Rekonstruktion von Mainz, Worms und Speyer um 800 und 1200
Prof. Dr.-Ing. Piotr Kuroczyński / Julia Merz M. A. (Architekturinstitut Hochschule Mainz)
Montag, 18. November 2019, 19.00 Uhr im MVB-Forum
Im Zuge der Landesausstellung Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht – Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa (9.9.2020-18.4.2021) entstehen seit September 2018 im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und dem Architekturinstitut der Hochschule Mainz quellenbasierte und damit wissenschaftlich fundierte, digitale 3D-Rekonstruktionen der drei Bischofsstädte am Rhein Mainz, Speyer und Worms in den Zeitschnitten um 800 und um 1250.
Neben der Rekonstruktion der Siedlungs- und Befestigungsstrukturen sowie der Kirchenlandschaft erfolgt auch eine Rückführung des Geländes und des Rheinverlaufs in den Zustand des frühen und hohen Mittelalters. Als Primärquellen und damit als Grundlage für die Rekonstruktion der drei Städte dienen dabei vor allem zeitgenössische Schriftquellen, jüngere historische Pläne und Karten, aber vor allem auch Ergebnisse zum Teil unpublizierter archäologischer Grabungen und neuere Forschungsarbeiten. Aufgrund eines Mangels an Quellen, gerade für den frühen Zeitschnitt um 800, werden darüber hinaus zusätzlich Analogien und Vergleichsobjekte für die Rekonstruktion herangezogen.
Die Ergebnisse der Recherchearbeiten werden zunächst in einem Geoinformationssystem (GIS) georeferenziert, in zweidimensionalen Karten zusammengefasst und ausgewertet. Anschließend erfolgt die Übersetzung der 2D-Grundlage in ein 3D-Modell der Stadt. Je Stadt und Zeitschnitt werden außerdem zwei Vertiefungsobjekte im Detail modelliert, im Falle von Mainz unter anderem der Mainzer Dom im Zustand um 1250 und – unter Einarbeitung der neuesten Forschungsergebnisse – St. Johannis um 800.
Die hinter den Modellen stehenden Informationen sowie die Arbeits- und Entscheidungsprozesse, die letztlich zum fertigen Modell führen, werden innerhalb einer virtueller Forschungsumgebung transparent gemacht und das Wissen hinter den hypothetischen Modellen nachhaltig dokumentiert und zur Verfügung gestellt. Der Vortrag wirft einen Blick hinter die Kulissen eines laufenden Digital Humanities-Projekts am Beispiel der Stadt Mainz, von der Quellenkritik bis zum fertigen, gedruckten 3D-Modell.
Historische Vereine – Geschichtsschreibung im Dienste des Vaterlandes (1815-1915)
Prof. Dr. Gabriele B. Clemens (Universität des Saarlandes)
Montag, 2. September 2019, 18.00 Uhr, im Forum der Mainzer Volksbank am Neubrunnenplatz
Im 19. Jahrhundert haben Geschichtsvereine Entscheidendes für den Aufbau und die Entwicklung der Geschichtswissenschaft und der Archäologie geleistet. In allen Geschichts- und Altertumsvereinen wandten sich die Honoratioren und Gebildeten verschiedenen Aufgabenfeldern zu: Der Herausgabe von Zeitschriften und wissenschaftlichen Publikationen, dem Aufbau von Bibliotheken, dem Denkmalschutz und der archäologischen Bodendenkmalpflege sowie schließlich den Sammlungen. Dabei setzten die Vereine verschiedene Schwerpunkte. Die Mainzer Gesellschaft konzentrierte sich wie benachbarte Vereine aufgrund des reichen archäologischen Erbes auf die Bodendenkmalpflege und den Aufbau einer Sammlung. Diese mündeten in die Gründung von renommierten Museen, die heute von den Ländern betreut werden. Zudem bleibt das Engagement der Vereine für die Pflege von regionalen Identitäten und regionalem Geschichtsbewusstsein bis zum heutigen Tag wertvoll und wichtig.
Mehr als nur stumme Architekturdenkmale. Die wiederaufgebauten Schlösser Mannheim und Bruchsal
Dr. Wolfgang Wiese (Konservator Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg)
Montag, 18. Februar 2019, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Schlösser stellen durch ihre Gestalt und Lage Highlights in Städten und Regionen dar. Als sichtbare Zeichen einer altehrwürdigen Vergangenheit sind sie kaum aus dem historischen Gedächtnis der Menschen zu streichen und verkörpern neben den großen kirchlichen und bürgerlichen Monumenten ein bedeutendes kulturelles Erbe. Doch Schlösser, nur als äußere, im Vorbeigehen wahrgenommene Erscheinungen zu betrachten, kann nicht wirklich zufrieden stellen, denn sie sind mehr als nur der architektonische Fassadenentwurf. Ihre Wirkung im städtischen Umfeld, das Innere als räumliche Erfahrung und die Botschaft ihrer ehemaligen Bewohner umfassen das Wesen von Schlössern im Zusammenhang. Sie sind also ein größeres Ganzes der Geschichte, das uns prägende Momente gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen wiedergibt.
Nicht selten haben Schlösser ihre herrschaftlichen Wurzeln durch mangelnde Nutzung oder Zerstörung verloren. Wie man mit jenen Verlusten umging, hat sich beim Wiederaufbau der hier ins Zentrum gestellten Monumente in Mannheim und Bruchsal gezeigt. Beide Schlösser erlitten schwere Schicksalsschläge durch Vernichtung und standen am Rande der kompletten Auslöschung. Aber das Bedürfnis der Menschen, die in ihrem Gedächtnis verankerten Denkmäler wieder aus Ruinen herzustellen, war groß. Keine Plattenbauten, sondern das durch die Erinnerung geprägte Ambiente wünschte man sich an ihren Standorten zurück. Die Hülle genügte nicht und der Blick ins Innere reizte zur Sichtbarmachung höfischer Lebenswelten, damit sich zeremonielle und repräsentative Bedingungen der Residenzen erklären ließen.
Wie wird ein Schloss definiert, war die Frage. Reichen zweckneutrale Ausstellungsräume aus? Die Projektierung sollte sich an der Geschichte der Orte orientieren und funktionelle Aspekte aufgreifen. Die Planung der Rekonstruktionsmethoden war dabei nicht einfach und eine konzeptionelle Herausforderung, wenn man etwa an die denkmalpflegerischen Vorgaben denkt. Aber auch finanzielle Belange oder zeitliche Dimensionen wurden zum Wagnis. Mit welchen baulichen Einschränkungen und doch erfolgreichen Strategien wurde vorgegangen, damit sich Chancen zur Verbesserung des kulturellen Angebots und der Erweiterung des touristischen Programms in jenen Städten eröffnen ließen, das soll der Vortrag vermitteln.
„Me uszgeben dan ingenomen“: Das Mainzer Rechnungswesen während des späten Mittelalters
Dr. David Schnur (Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd)
Montag, 14. Januar 2019, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Im Zentrum des Vortrags stehen die heute nur noch teilweise überlieferten Haupt- und Sonderrechnungen der rheinischen Kathedralstadt Mainz des späten Mittelalters. Nach einem Überblick über die komplexe Überlieferungsgeschichte und -situation soll in einem zweiten Schritt die Buchführungspraxis untersucht werden, die im Untersuchungszeitraum verschiedenen Innovationen unterworfen war. Eine Einbettung in größere Zusammenhänge erfolgt durch die Berücksichtigung der finanziellen und verfassungsrechtlichen Entwicklungen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, welche durch häufige Regimentswechsel im städtischen Rat sowie eine exorbitante und weiter anwachsende Gesamtverschuldung geprägt waren. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die unter Einwirkung der zur Hilfe gerufenen Bundesstädte aus Frankfurt, Speyer und Worms ergriffenen Maßnahmen, die mittel- bis langfristig eine Besserung der finanziellen Situation erwirken sollten.
Moguntinen-Beratung: Alles, was Mainz ist
Samstag, 23. November 2019, 14.00-16.00 Uhr im Landesmuseum Mainz
Experten aus den Bereichen Geschichte, Buchkunde, Archäologie und Kunstgeschichte begutachten Ihre Moguntinen. Mainz-Ansichten, Mainzer Drucke und andere Altertümchen mit einem Bezug zur Stadt und zu ihrem Umland werden unter die Lupe genommen und nach besten Wissen kommentiert (ohne Wertangabe).
Die vorherige Einsendung von Fotos mit weiteren eventuell schon vorhandenen Informationen zu den Objekten ist erwünscht an: info(at)mainzer-altertumsverein.de
Dieses Angebot in Kooperation mit dem Landesmuseum Mainz richtet sich an jedermann und ist ein Geschenk des Mainzer Altertumsvereins an die Öffentlichkeit aus Anlass seines 175jährigen Bestehens. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die Region um Mainz nach dem Ausbruch des Tamboravulkans vom April 1815 - Aspekte einer Lebensweltkrise
Montag, 5. Februar 2018, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Prof. Dr. Helmut Hildebrandt (Mainz)
In den letzten Jahren scheint die Vulkantätigkeit rund um den Globus zuzunehmen. Sie rückt vor allem dann in unser Bewusstsein, wenn der internationale Flugverkehr beeinträchtigt wird und Tausende Reisende auf Flughäfen stranden. Das kilometerhoch transportierte Auswurfmaterial stellt aber nicht nur eine Bedrohung für die Luftfahrt dar, sondern wirkt sich auch negativ auf das Klima aus und beeinträchtigt die Landwirtschaft und andere Bereiche unserer Lebenswelt.
Besonders gefährlich sind die Vulkane, die sich in der äquatorialen Zone befinden, wie z.B. aktuell der Mt. Agung auf Bali. Die Ausbrüche dieser Vulkane innerhalb der sogenannten Innertropischen Konvergenzzone, die ihr Auswurfmaterial bis weit in die Stratosphäre schleudern, beeinflussen das Klima sogar weltweit.
In direkter Nachbarschaft zum Mt. Agung liegt auch der Tambora-Vulkan, der im Jahre 1815 einen verheerenden Ausbruch erlebte. Wie hat sich dieser spektakuläre Ausbruch in den Folgejahren 1816 und 1817 in der Lebenswelt rund um Mainz im Alltagsleben konkret bemerkbar gemacht?
War auch hier 1816, wie in vielen Gebieten Mittel- und Westeuropas ein „Jahr ohne Sommer“?
Der Referent geht diesen Fragen in seinem Vortrag nach und hat dazu interessante Antworten gefunden.
Die Mainzer Künstler des 18. Jahrhunderts von A-Z
Dienstag, 6. März 2018, 18.00 Uhr im Landesmuseum Mainz, Große Bleiche 49-51
Prof. Ullrich Hellmann (Mainz)
Rund einhundert Jahre nach Veröffentlichung der „Aufsätze und Nachweise zur Mainzer Kunstgeschichte“ von Heinrich Schrohe, die 1912 als Band 2 der „Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz“ erschienen sind, gibt es von Prof. Ullrich Hellmann einen neuen Überblick zu den Malern, Bildhauern, Kupferstechern, Buchdruckern etc. dieser Zeit in Mainz. Das Lexikon bietet mit seinen biografischen Daten umfangreiche Informationen zur Kunst- und Sozialgeschichte.
Anlässlich der Präsentation des Lexikons im Landesmuseum Mainz werden einige ausgewählte Künstlerbiografien näher betrachtet. Im Mittelpunkt steht dabei der Hofbildhauer Peter Heinrich Hencke. Außerdem wird aus dem Leben des Hofvergolders Franz Joseph Ignaz Anton Heideloff berichtet, dessen Kinder und Enkel in Wien, Stuttgart, Nürnberg und andernorts erfolgreich gearbeitet haben. Auch die Malerfamilie Seeland und das Wirken von Edmund Seeland in Mainz und Aschaffenburg wird vorgestellt.
Das Landesmuseum hat einen umfangreichen Bestand an Werken von Künstlern des 18. Jahrhunderts. Mit der Präsentation des Lexikons im Vortragssaal des Museums verbindet sich die Gelegenheit, Arbeiten der genannten Künstler zu zeigen. Unser Beiratsmitglied Gernot Frankhäuser, der als Moderator die Vorstellung des Lexikons begleitet, wird einige Arbeiten auswählen und erläutern.
„Ehemals jüdisches Vermögen“ – Finanzamtsüberweisungen im Landesmuseum Mainz. Ein Werkstattbericht
Emily Löffler M.A. (Landesmuseum Mainz)
Montag, 24. September 2018, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Das Landesmuseum Mainz verwahrt einen Bestand von 61 Gemälden, rund 160 Graphiken und einigen Möbelstücken, die mit der Provenienz „jüdischer Besitz“ in der hausinternen Dokumentation verzeichnet sind und in den Jahren 1941-1944 als Überweisungen der Reichsfinanzverwaltung an die Gemäldegalerie und das Altertumsmuseum der Stadt Mainz übereignet wurden. Der Bestand wurde vom Landesmuseum seit den 1990er Jahren systematisch dokumentiert und bei Organisationen wie dem World Jewish Congress gemeldet. Die Objekte wurden außerdem als „Fundmeldungen“ in die Lost Art Datenbank eingestellt. Da diese Maßnahmen kaum zur Klärung der Herkunfts- und Eigentumsverhältnisse beitragen konnten, wird der Bestand seit April 2016 im Rahmen eines von der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste geförderten Forschungsprojekts systematisch erforscht.
Wie betreibt man diese Art der Forschung? Warum hat die Reichsfinanzverwaltung den städtischen Museen Kunstgegenstände überantwortet? Wie lief dieser Vorgang ab, und warum gelten Überweisungen des Finanzamtes als problematische Provenienzen? Welche Ergebnisse haben die bisherigen Forschungen erbracht, und was bedeuten sie für die Mainzer Stadtgeschichte?
Diesen Fragen wird die Referentin in ihrem Vortrag nachgehen.
Gottes Wille und Menschenwerk – Mainz im Dreißigjährigen Krieg
Prof. em. Dr. Georg Schmidt (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Montag, 26. November 2018, 19.00 Uhr im MVB-Forum (nach der Jahresmitgliederversammlung)
Der Dreißigjährige Krieg wurde seit dem Erscheinen eines riesigen Kometen im Herbst 1618 als Gottes Wille und Strafgericht gedeutet. Diese Wahrnehmung entlastete Täter (und Opfer), weil Gott für den Krieg, die Gewalt und die Grausamkeiten verantwortlich zeichnete. Sie verlor sich erst nach vielen Jahren. Dann dämmerte es auch den Fundamentalisten, dass die Menschen Frieden schließen mussten, wenn sie sich nicht selbst vernichten und die Mitte Europas zur Wüste machen wollten. Der lange Krieg besiegte „die Reiter der Apokalypse“. Der Friede wurde Menschenwerk und die Aufklärung konnte beginnen. Aus protestantischer Sicht waren das Kurfürstentum und die Stadt Mainz nicht nur ein Teil der „Pfaffengasse“; sie gehörten zu den Festungen des römischen Antichristen. Die Schweden besetzten Mainz und steuerten von hier aus ihr „deutsches“ Reich. Schließlich aber war es der neue Erzbischof und Erzkanzler Johann Philipp von Schönborn, der entschieden für den friedlichen Ausgleich in Westfalen eintrat.
Marcel Lods in Mainz. Archäologie einer Stadtutopie der Nachkriegszeit
Assoz. Prof. Ing. Volker Ziegler (Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg)
Montag, 10. Dezember 2018, 18.00 Uhr im MVB-Forum
1945 ist das 2000-jährige Mainz eine zerstörte Stadt, deren rechtsrheinische Gebiete mit den Industrie- und Hafenstandorten in der amerikanischen Zone liegen. Der französische Oberbefehlshaber Pierre Koenig residiert in Baden-Baden, doch geplant ist, an die napoleonischen Planungen anzuknüpfen und ein französisch geprägtes Mayence zur Hauptstadt eines rheinischen Vasallenstaates auszubauen. Für diese Aufgabe wird Anfang 1946 Marcel Lods berufen, der als Mitglied der CIAM-Gruppe ein Verfechter einer funktionalistischen Moderne ist und mit Le Corbusier zu Themen des Wiederaufbaus und zur Charta von Athen korrespondiert.
Kaum bekannt und bisher unveröffentlicht sind die minutiösen Vorarbeiten zu Lods' Planung. Sogleich nach seiner Beauftragung stürzt dieser sich in die Planungsarbeit und kann schon im Mai 1946 einen ersten Bericht mit Analysen und Vorschlägen zum Wiederaufbau von Mainz fertigstellen. Zugleich beginnt sein Planerteam mit gründlichen Untersuchungen im Planungsgebiet, denn viele Dokumente waren im Krieg verschwunden. Diese Arbeiten werden 1947 zu einem Album zusammengestellt und sollen, durch die Brille der Charta von Athen gelesen, als Grundlage für eine - nie erschienene - Publikation dienen. Im Vortrag wird anhand von Lods' Manuskriptalbum auf dessen Begegnung mit der Stadt Mainz, seine Arbeitsweise, Überlegungen und Überzeugungen eingegangen, um zu einem differenzierteren Bild seines als unrealisierbar begriffenen Stadtentwurfs zu gelangen.
Karolingische Architektur und Gartenbaukunst im Odenwald
Samstag, 1. September 2018, 8.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr
Die zweite Tagesexkursion geht in den Odenwald: Bei Steinbach nahe Michelstadt steht die Einhards-Basilika als eine der wenigen noch existierenden karolingischen Kirchen.
In Kirchbrombach weist der spätgotische Flügelaltar eine der ältesten Mainzer Stadtansichten auf und ist ein Zeugnis dafür, wie vor 500 Jahren die fürstbischöfliche Metropole auch kulturell in die Provinz ausstrahlte.
Die Mauern des römischen Kastels und der Besuch des Englischen Gartens bei Eulbach, den die Grafen von Erbach in den ersten Jahren des 19. Jh.s anlegten, bilden den Abschluss des Tages.
Treffpunkt: 8.30 Uhr zur Abfahrt mit dem Reisebus an der „Nordsperre“ des Hauptbahnhofs
Teilnahmegebühr: 40,00 €
Wenn Sie mitfahren möchten, überweisen Sie bitte den Reisepreis unter Angabe des Reiseziels „Odenwald“, Ihres Vor- und Zunamens und Ihrer Telefonnummer auf das Exkursionskonto des Altertumsvereins bei der MVB, IBAN: DE71 5519 0000 0022 0990 22, BIC: MVBMDE55.
Bei Rücktritt nach dem 3.8.2018 behalten wir € 15,- p. P. als Kostendeckungsbeitrag ein.
Leitung: Gernot Frankhäuser
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: gernot.frankhaeuser(at)gdke.rlp.de oder Tel. 06131 / 28 57 145
Der heilige Alban von Mainz und der Albansaltar in Kirchbrombach, Odenwald
Dr. Michaela SCHEDL (Frankfurt a. M.)
Montag, 9. Januar 2017, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Der Legende nach erlitt der Priester und Missionar Alban, Schutzpatron von Mainz, Anfang des 5. Jahrhunderts in der Rheinstadt den Märtyrertod. Ihm zu Ehren wurde die Benediktinerabtei St. Alban, südlich der Stadt auf dem Albansberg gelegen, Anfang des 9. Jahrhunderts geweiht. Verschiedene Ereignisse erinnern an die einstige Bedeutung des Klosters. 794 wurde hier die Gemahlin Karls des Großen begraben, in den folgenden Jahrhunderten auch mehrere Mainzer Erzbischöfe. Das einst blühende Kloster, bedeutendes Zentrum kulturellen Schaffens und Austragungsort verschiedener Kirchen- und Reichsversammlungen, wurde 1329 erstmals und erneut 1552 zerstört und danach nicht wieder aufgebaut. Einzelne Objekte und Fragmente, die in Museen aufbewahrt werden, erinnern heute noch an die einst so mächtige Abtei.
Wie die Klostergebäude und -kirche kurz vor ihrer Zerstörung aussahen, veranschaulicht die Malerei auf einem prächtigen Flügelaltar, der in der evangelischen Kirche St. Alban in Kirchbrombach im Odenwald steht. Aktuelle Überlegungen deuten darauf hin, dass dieses Retabel von der Familie eines Mainzer Chorherrn gestiftet wurde. Und auch zu dem Künstler gibt es eine von der Referentin aufgestellte neue Hypothese: Sehr wahrscheinlich wurde der Schreinaltar von dem Frankfurter Maler und Bildhauer Mathis Grün geschaffen, dessen Biographie in der Forschung bis vor kurzem mit der des auch für Mainz wichtigen Malers Mathis Gothart Nithart genannt Grünewald verquickt worden war.
Joseph Martin Kraus in der kurfürstlichen Residenzstadt Mainz 1773
Dr. Franz Stephan Pelgen M.A. (Mainz)
Montag, 30. Januar 2017, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Über die Jugendzeit des im kurmainzischen Odenwald geborenen und aufgewachsenen Komponisten Joseph Martin Kraus (1756-1792), der im gustavianischen Schweden bis zum königlichen Hofkapellmeister aufstieg, gab es bisher wenige verlässliche Informationen. Unser Vorstandsmitglied Franz Stephan Pelgen hat wichtige Quellen zu Kraus' Studienjahr an der Mainzer Universität entdeckt, ist Beiratsmitglied der Joseph Martin Kraus-Gesellschaft in Buchen und stellt uns den selbstbewussten Joseph Martin Kraus als empfindsamen 17jährigen im emmerizianischen Mainz des Jahres 1773 vor. Der 40minütige Vortrag ist reich bebildert, und eines der neu entdeckten Krausschen Schäfergedichte wird rezitiert werden.
Quellen zur Mainzer Geschichte von 1918 bis in die 1950er Jahre in Pariser Archiven
Dr. Michael MARTIN (Landau)
Montag, 6. März 2017, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Der Referent war 24 Jahre lang Leiter des Stadtarchivs Landau, einer Stadt mit langer französischer Vergangenheit. Seit Jahren forscht er in verschiedenen Pariser Archiven und stößt dabei immer wieder auf noch unausgewertete Quellen zur rheinland-pfälzischen Geschichte.
Die Ersterwähnung Erfurts 742 und die Anfänge seiner Verbindung mit Mainz
Montag, 26. Juni 2017, 19.00 Uhr im MVB-Forum (nach der Jahresmitgliederversammlung)
Univ.-Prof. Dr. Karl Heinemeyer (Erfurt)
Nach Beendigung der Mitgliederversammlung wird der neu erschienene Band 78 (2017) der Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt durch Redakteur Dr. Steffen Raßloff vorgestellt. Der Band setzt einen Schwerpunkt auf die Ersterwähnung Erfurts im Jahr 742 und insbesondere auch auf die historischen Beziehungen zwischen den Städten Mainz und Erfurt.
Im Anschluss daran referiert der Vorsitzende des mit dem Mainzer Altertumsverein freundschaftlich verbundenen Erfurter Geschichtsvereins Prof. Dr. Karl Heinemeyer über die Ersterwähnung Erfurts vor 1275 Jahren im Rahmen der Bistumsgründungen von Bonifatius und über die Anfänge der engen Verbindungen zwischen Mainz und Erfurt, die heute durch eine lebendige Städtepartnerschaft getragen werden.
Friesische Händler und der frühmittelalterliche Handel am Oberrhein
Montag, 25. September 2017, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Jens Boye Volquartz, M.A. (Universität Kiel)
Die fränkische Eroberung der friesischen Kernlande in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts löste eine Handelsexpansion aus, die heute als „Friesenhandel“ bekannt ist. Friesische Händler befuhren im Frühmittelalter Routen von der Nordsee bis zu den Alpen und gründeten entlang ihrer Fahrtstrecken sogenannte „Friesenviertel“ – so auch am Oberrhein in Mainz und Worms.
Schriftquellen und archäologische Untersuchungen aus den Stadtbereichen geben erstaunliche Informationen zu den Friesen am Oberrhein preis. So werden Handelsrouten, Partner und Konkurrenten, Schiffe und Logistik sowie Teile des Warensortiments der friesischen Händler sichtbar – auch im Vergleich zum sonstigen Handel am Oberrhein. Nicht zuletzt hatten die Friesen mit ihrer besonderen Form der Ansiedlung vor den Mauern der mittelalterlichen Bischofsstädte am Oberrhein eine Auswirkung auf die Stadtentwicklung, die zur Ausbildung eines nur am Oberrhein in dieser Form zu findenden Stadttypus führte. Dessen Spuren sind auch nach dem Verschwinden der friesischen Händler im 10. Jahrhundert bis heute im Stadtbild wiederzufinden.
Die reformatorische Bewegung in der erzbischöflichen Metropole Mainz: anfängliche Erfolge und frühes Scheitern
Montag, 6. November 2017, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Prof. Dr. Wolfgang Dobras (Stadtarchiv Mainz)
Sehr früh bildete sich eine reformatorische Bewegung in der Stadt Mainz. Zu ihren ersten Aktionen gehörte, dass im November 1520 Mainzer Bürger den päpstlichen Nuntius Aleander daran hinderten, Schriften Luthers öffentlich zu verbrennen. Kurz zuvor hatte Caspar Hedio begonnen, von der Domkanzel herab im reformatorischen Sinne zu predigen. Doch der Aufstand der Bürgerschaft, der während des Bauernkriegs 1525 gesellschaftliche, wirtschaftliche und auch kirchliche Reformen herbeiführen sollte, wurde von Kurfürst Albrecht von Brandenburg niedergeschlagen. Das Scheitern bedeutete das Aus für die weitere Verbreitung der Reformation. Der Vortrag untersucht die Gründe dafür und entwirft ein Panorama des kirchlichen und religiösen Lebens in der kurfürstlichen Metropole zur Zeit der Reformation.
Mainzer Rheinuferforum von 1944 – eine Planungsdemonstration
Montag, 11. Dezember 2017, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Dr.-Ing. Rainer Metzendorf (Mainz)
Öffentliche Gebäude in Mainz, vom Römischen Theater über das Kurfürstliche Schloss bis hin zum heutigen Rathaus, erhielten als gesellschaftspolitische Manifeste möglichst die prominentesten Standorte dieser Stadt, die am Rhein.
1944 ließ Reichsminister Albert Speer von Berlin aus für Mainz ein Gauforum am Rhein planen, das mit Parteibauten samt Aufmarschplätzen um das historische Schloss das Zentrum einer nationalsozialistisch geprägten Nachkriegsstadt bilden sollte.
Der Mainzer Stadtplaner und Architekt Dr.-Ing. Heinz Knipping entwarf 1944 hierzu eine Alternative. Seine Planungen waren bisher unbekannt und galten als verschollen. 2016 gelangten sie über einen privaten Nachlass in das Stadtarchiv Mainz.
Knippings Rheinuferplanung vom Schloss bis zum Winterhafen ist eine Demonstration lokalspezifisch geprägter, zeitgenössischer Auffassung von Stadtbaukunst und Architektur. Ihre Sonderstellung gegenüber anderen Foren und Zentren der „Neuen Zeit“ wird in dem Vortrag vergleichend behandelt.
WÜRZBURG: JULIUS ECHTER UND SEINE ZEIT
SAMSTAG, 15. JULI 2017
Julius Echter (1545 - 1617) gehört zu den berühmtesten Gestalten in der Zeit der sog. Gegenreformation in Deutschland. Als Mainzer Domherr versuchte er mehrfach, die Kurwürde zu erringen, während er als Bischof von Würzburg und „Herzog von Franken“ in mehr als 40 Jahren eine äußerst vielfältige Tätigkeit am Main entfaltete.
Die Besuche des Doms und abschließend der Residenz gehen u. a. den engen Verflechtungen und vielfältigen Beziehungen zwischen Mainz und Würzburg nach.
VORMITTAG
Museum am Dom: Geführter Besuch der Ausstellung Julius Echter. Der umstrittene Fürstbischof.
Julius Echter von Mespelbrunn, der 44 Jahre lang als Fürstbischof von Würzburg herrschte, prägte Mainfranken nachhaltig. Sein 400. Todestag ist Anlass für die Diözese Würzburg, diesen Abschnitt ihrer Geschichte offen und kritisch zu behandeln und in einer aufwendigen Ausstellung mit Hilfe zahlreicher nationaler und internationaler Exponate vor Augen zu führen.
Führungen im Dom: Die Geschichte des Gebäudes und seine Stellung in der romanischen Architektur sowie Die Grabdenkmäler der Echter-Zeit und weitere Höhepunkte der Ausstattung.
MITTAG
Zeit zur eigenen Erkundung der Innenstadt und Gelegenheit zum Mittagessen auf eigene Faust (Oberer und Unterer Markt, Rathaus mit Ratskeller, alte Mainbrücke).
Empfehlungen für die Mittagszeit werden gemeinsam mit weiteren Unterlagen am Exkursionstag gegeben.
NACHMITTAG
Martin von Wagner-Museum in der Residenz: Geführter Besuch der Ausstellung Julius Echter, Patron der Künste. Konturen eines Fürsten und Bischofs der Renaissance.
Dieser Teil der Ausstellung nimmt vor allem Echters Wirken in Kunst, Architektur und Wissenschaften in den Fokus.
Geführter Besuch in der Residenz: Treppenhaus, Weißer Saal und Kaisersaal, die von Giambattista Tiepolo und Bossi 1750-1753 ausgestattet wurden.
Gelegenheit zu einem Imbiss in der Residenzgaststätte B. Neumann oder Gelegenheit zur Promenade im Hofgarten.
Abfahrt: Samstag, 15. Juli 2017, 7.30 Uhr Abfahrt Mainz Hbf, Nordsperre
Rückkehr: ca. 20.30 Uhr in Mainz
Leistungen: Komfortabler Reisebus, Sämtliche Führungen und Eintritte
Bitte beachten Sie, dass die Zahl der Teilnehmer/-innen auf 40 Personen begrenzt ist.
Preis für Mitglieder € 40,- und für Gäste € 45,-
Wenn Sie mitfahren möchten, überweisen Sie bitte den Reisepreis unter Angabe des Reiseziels, Ihres Vor- und Zunamens und Ihrer Telefonnummer auf das Exkursionskonto des Altertumsvereins bei der MVB, IBAN: DE71 5519 0000 0022 0990 22, BIC MVBMDE55.
Bei Rücktritt nach dem 24. Juni 2017 behalten wir € 15,- p. P. als Kostendeckungsbeitrag ein.
Leitung: Gernot Frankhäuser
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: gernot.frankhaeuser(at)gdke.rlp.de oder Tel. 06131 / 28 57 145
TAUBERBISCHOFSHEIM
SAMSTAG, 2. SEPTEMBER 2017
Unsere Spätsommerexkursion führt uns in die alte Kurmainzer Amtsstadt Tauberbischofsheim, das bereits unter Bonifatius in die Hand der Mainzer Kirche gelangt ist. Unter fachkundiger Führung von Frau Irmgard Wernher-Lippert von den Tauberfränkischen Heimatfreunden werden wir auf einem Rundgang die Stadt mit der romanischen Peterskapelle und der Stadtpfarrkirche St. Martin mit ihrer spätgotischen und barocken Ausstattung erkunden, bevor am Nachmittag nach einem Mittagessen in einem von einem Mainzer Posthalter erbauten Hof die Besichtigung des Museums im Schloss, dem Sitz der Kurmainzer Amtmänner, auf dem Programm steht. Wer gut zu Fuß ist, kann außerdem den erhaltenen Bergfried des Vorgängerbaus des Schlosses, den Türmersturm, erklimmen und von dort eine wunderbare Aussicht auf Tauberbischofsheim genießen.
Abfahrt Mainz: 8.00 Uhr, Hbf, Nordsperre
Ankunft in TBB (Parkbucht 8, Wörtplatz) 10.00 Uhr: Zweistündiger Stadtrundgang in 2 Gruppen mit Frau Wernher-Lippert und Frau Schwarz (mit Stadtpfarrkirche St. Martin und Peterskapelle)
12.00 Uhr: Mittagessen im Badischen Hof
14.00 Uhr: Besichtigung des Kurmainzischen Amtsschlosses (mit dem hervorragend ausgestatteten Tauberfränkischen Landschaftsmuseum)
15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen ebenda im Jägerhäuschen, dem Café des Vereins der Tauberfränkischen Heimatfreunde (anschließend Möglichkeit zur Besteigung des Türmersturms auf 123 Stufen)
16.30 Uhr: Abfahrt nach Gerlachsheim. Besichtigung der Rokokokirche des ehemaligen Prämonstratenserklosters
17.30 Uhr: Rückfahrt nach Mainz
Ca. 20 Uhr: Ankunft in Mainz
Abfahrt: Samstag, 2. September 2017, 8.00 Uhr Abfahrt Mainz Hbf, Nordsperre
Rückkehr: ca. 20.00 Uhr in Mainz
Leistungen: Komfortabler Reisebus, Sämtliche Führungen und Eintritte
Bitte beachten Sie, dass die Zahl der Teilnehmer/-innen auf 40 Personen begrenzt ist.
Preis für Mitglieder € 30,- und für Gäste € 35,-
Wenn Sie mitfahren möchten, überweisen Sie bitte den Betrag unter Angabe des Reiseziels, Ihres Vor- und Zunamens und Ihrer Telefonnummer auf das Exkursionskonto des Altertumsvereins bei der MVB, IBAN: DE71 5519 0000 0022 0990 22, BIC MVBMDE55.
Bei Rücktritt nach dem 31. Juli behalten wir € 10,- p. P. als Kostendeckungsbeitrag zurück.
Organisation und Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Dobras
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: wolfgang.dobras(at)stadt.mainz.de oder Tel: 06131-12 26 56
Edgar Reitz‘ Film „Die andere Heimat“ und ich
Montag, 11. Januar 2016, 18 Uhr im MVB-Forum
Helma HAMMEN (Schlierschied)
Die Hunsrückerin Helma Hammen wird erzählen, wie sie 2011 von Regisseur Edgar Reitz zur Mit-arbeit an dessen Film „Die andere Heimat“ gewonnen wurde und worin ihre Aufgabe beim Hunsrück Casting bestand. Freuen Sie sich auf einen aufschlussreichen Blick hinter die Kulissen dieses großen Filmprojekts, das in beeindruckenden Bildern Heimatgeschichte als eine Gesellschaftsgeschichte des Hunsrück im Vormärz erlebbar macht.
Reichklara und Armklara – zwei Klarissenklöster in der Zeit der katholischen Reform
Montag, 15. Februar 2016, 18 Uhr im MVB-Forum
Sigrun Müller (Frankfurt a. M.)
Im Zentrum steht ein analytischer Vergleich zwischen den beiden Mainzer Klarissenklöstern, die sich auf eine gemeinsame Ordensgründerin beriefen, jedoch nach eigentlich entgegengesetzten Regeln ausgerichtet waren. Das ältere, im 13. Jh. errichtete Reichklara berief sich zwar auf Klara von Assisi, richtete sich jedoch nach der von Papst Urban IV. 1263 entworfenen Regel, die den Nonnen gemeinschaftlichen Güterbesitz erlaubte, damit sie nicht zum Betteln umherziehen mussten. Dies widersprach der von Klara von Assisi vertretenen radikalen Armut. Die Observanzbewegung des 14. Jahrhunderts strebte daher eine Rückkehr zu den Idealen der Ordensgründer an, allerdings erfolgte eine Reformierung Reichklaras erst in nachtridentinischer Zeit. Dagegen war das zweite Mainzer Klarissenkloster von Erzbischof Johann Schweikhard von Kronberg 1620 bewusst als Reformkloster im Sinne des Tridentinums gegründet worden. Die Frauengemeinschaft sollte ohne Gemeinschaftsbesitz und fast nur von Almosen leben. Diese unterschiedlichen Aspekte des Klosterlebens in der Frühen Neuzeit werden im Vortrag gegenübergestellt.
Dietrich Schro - der Mainzer Bildhauer und Medaillenschneider der Renaissance
Dr. Ursula B. Thiel (Nackenheim)
Montag, 11. Juli 2016, 19.00 Uhr im MVB-Forum (nach der Jahresmitgliederversammlung)
Von der Forschung bisher nicht ausreichend gewürdigt, war Dietrich Schro einer der hervorragendsten deutschen Bildhauer und Porträtisten des 16. Jahrhunderts. Als selbstständiger Bildhauermeister führte er nach Peter Schro (†1542/44) bis zu seinem eigenen Tod (†1572/73) die renommierte Schro-Werkstatt in Mainz und genoss weit über die Grenzen der Stadt hinaus hohes Ansehen. Zu seinen einflussreichen und künstlerisch anspruchsvollen Auftraggebern zählten u. a. Kunstmäzene wie Kardinal Albrecht von Brandenburg und Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz. Neben höchst repräsentativen Werken wie z. B. den Epitaphien der beiden Mainzer Erzbischöfe Albrecht von Brandenburg und Sebastian von Heusenstamm schuf er außerdem Kunstkammerstücke, Porträtmedaillen und Kleinskulpturen, wie sie bei Adel und höchstem Klerus sehr beliebt waren.
Mainzer Maler – Maler in Mainz. Lebenswelten zwischen Stadt und Hof
Dr. Benjamin D. Spira M.A. (Mainz)
Montag, 10. Oktober 2016, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Heinrich Schrohe seine bis heute grundlegende Untersuchung zu den Künstlern der kurfürstlichen Epoche publiziert. Ergänzend hatte sich annähernd 100 Jahre später auch Josef Heinzelmann, langjähriges Mitglied des Mainzer Altertumsvereins, mit den hier ansässigen Bildhauern und Malern der Frühen Neuzeit beschäftigt. Auf diesen Arbeiten baut der Vortrag auf, der die Ergebnisse einer 2013 eingereichten Dissertationsschrift zusammenfasst. Dabei soll der Versuch unternommen werden, ein Bild von den Lebensverhältnissen der in Mainz tätigen Maler zu gewinnen. Hierbei bilden das Ende der Mainzer Stiftsfehde (1462) und die Eroberung durch die Truppen des Schwedenkönigs Gustav Adolf (1631) die zeitlichen Eckpunkte der Untersuchung. Anstelle stilgeschichtlicher Erläuterungen werden Fragen zur Finanzkraft, dem sozialen Beziehungsgeflecht, Herkunfts- und Wohnorten sowie grundlegend zur Zahl der in Mainz ansässigen Maler erörtert. Zumindest am Rande sollen daneben auch die bürgerlichen und zünftigen Ordnungen vorgestellt werden, die die Rahmenbedingungen jeder Tätigkeit in Mainz bildeten.
Römische Sklaverei in Mainz – Die Inschriften der Sklaven und Freigelassenen
Dr. Oliver Schipp (Mainz)
Montag, 7. November 2016, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Sklaven und Freigelassene sind im römischen Mainz in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten vielfach inschriftlich nachgewiesen. Im Vortrag werden diese Zeugnisse der Unfreiheit vorgestellt. Neben einem Überblick über die gesellschaftliche Relevanz der uns bekannten Unfreien in Mainz werden verschiedene Facetten der Sklaverei an inschriftlichen Beispielen verdeutlicht. Außerdem sollen die Ursachen für den Rückgang der Sklaverei in Mainz seit dem dritten Jahrhundert diskutiert werden. Als ein Grund hierfür ist die sinkende Zahl der Sklaven im Römischen Reich anzunehmen. Auch schwand mit dem Truppenabzug am Ende des ersten Jahrhunderts der Anteil der mediterranen Bevölkerung und zugleich die Zahl der Unfreien. Schließlich wird dargelegt, dass immer seltener Grabsteine gesetzt wurden, aus denen wir den Status von Sklaven und Freigelassenen erfahren.
„Bilderappetit“ – Sammler und Sammlungen im Mainz des 17. bis 20. Jahrhunderts
Gernot Frankhäuser (Mainz)
Montag, 12. Dezember 2016, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Das Sammeln von Kunst um der Kunst willen wird in Mainz in den Jahrzehnten nach dem 30jährigen Krieg zum ersten Mal fassbar. Adlige Domherren begründen eine Tradition privater Sammelleidenschaft, die im späten 18. Jahrhundert auch das Bürgertum ergreift und in den 1930er Jahren vorerst endet. Der Vortrag stellt einige Sammlerpersönlichkeiten und einige herausragende Gemälde aus ehemals Mainzer Besitz vor. Insgesamt handelt es sich hierbei um eine Geschichte von Verlusten und Versäumnissen, aber trotz der lückenhaften Überlieferung lässt sich daraus ein imaginäres Museum der europäischen Malerei rekonstruieren.
Sonderausstellung „Schrei nach Gerechtigkeit: Leben am Mittelrhein am Vorabend der Reformation“
Freitag, 15. Januar 2016, 15.15 Uhr im Dommuseum, Domstr. 3
Wer seine Kenntnis von der beeindruckenden Präsentation von Kunst und Kultur am Mittelrhein um 1500 im Dommuseum vertiefen und noch einmal einen Blick auf die hochkarätigen Exponate werfen möchte, ist zu dieser 90-minütigen Führung kurz vor Ausstellungsende herzlich eingeladen.
Bitte melden Sie sich bis zum 7. Januar 2016 bei Frau Bestle an, ob Sie teilnehmen wollen (info(at)mainzer-altertumsverein.de oder Tel. 06131/229442).
Treffpunkt ist um 15.15 Uhr vor dem Eingang zum Dommuseum, Domstr. 3. Führungs- und Eintrittsgebühr betragen pro Teilnehmer/in 12,- € und werden unmittelbar vor der Führung erhoben.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Wolfgang Dobras, Tel. 06131/122656 oder E-Mail wolfgang.dobras(at)stadt.mainz.de.
Sonderausstellung in Trier: „NERO: KAISER, KÜNSTLER UND TYRANN“
Samstag, 28. Mai 2016
Das Rheinische Landesmuseum Trier präsentiert im Sommer 2016 eine große Sonderausstellung, die dem Leben und der Regierung des römischen Kaisers Nero (54-68 n. Chr.) gewidmet ist, mit hochkarätigen Leihgaben aus dem In- und Ausland.
Neros Mutter, die in Köln geborene Agrippina die Jüngere, war in dritter Ehe mit Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) verheiratet und brachte in diese Ehe ihren Sohn Nero mit. Die sehr ehrgeizige Agrippina sorgte dafür, dass ihr Sohn bereits im jugendlichen Alter von 17 Jahren die Nachfolge ihres Ehemanns als Kaiser antrat. Die Regentschaft Neros, die 68 n. Chr. ein tragisches Ende fand, erscheint in der Sicht der römischen Historiker, wie Tacitus und Sueton, eher negativ. Andererseits war Nero in seinen ersten Regierungsjahren beim Volk sehr beliebt, er förderte die Künste und trat auch selbst als Künstler auf. Auch in Mainz gibt es einen Bezug zu Nero: die große Jupitersäule, die Nero von den Mainzern zwecks Loyalitätsbekundung gestiftet wurde.
Wir werden in Trier nicht nur durch die Nero-Sonderausstellung im Landesmuseum fachkundig geführt, sondern auch UNESCO-Welterbe-Stätten, wie den Dom, die Liebfrauenkirche und die römische Basilika, sehen. Außerdem unternehmen wir, ausgehend vom Palais des Trierer Kurfürsten, einen Spaziergang durch den Palastgarten. Der Tag klingt, nach Aufnahme vieler geistiger Genüsse, mit einer Einkehr zur Aufnahme auch leiblicher Genüsse aus.
Abfahrt: 8:30 Uhr, Hauptbahnhof Mainz, Nordsperre
Rückkehr: ca. 20:00 Uhr
Der Reisepreis in Höhe von 43 Euro für MAV-Mitglieder bzw. 48 Euro für Gäste beinhaltet folgen-de Leistungen: Busreise, Eintritts- und Führungsgebühren.
Überweisen Sie bitte den entsprechenden Betrag unter Angabe des Reiseziels, Ihres Namens und Ihrer Telefonnummer auf das Exkursionskonto des Mainzer Altertumsvereins bei der Mainzer Volksbank, IBAN: DE71 5519 0000 0022 0990 22 (vormals Konto-Nr. 22099022, BLZ 55190000).
Bitte beachten Sie, dass alle Geldinstitute Aufträge, die nach dem 31. Januar 2016 erfolgen, nur noch als SEPA-Überweisungen, mit alleiniger Angabe der IBAN, akzeptieren.
Bei Rücktritt nach dem 30. April 2016 behalten wir einen Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 10,- Euro zurück.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Reiseleiter:
Dr. Michael Klein, Tel. 06221 / 20840 oder 0176 / 73683307; E-mail: zobel.klein(at)gmail.com
„200 Jahre Rheinhessen“
Samstag, 20. August 2016
Zu diesem Jubiläum bietet Ihnen der Altertumsverein eine Exkursion an, die Ihnen nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern auch einige bauliche und geschichtliche Besonderheiten Rheinhessens nahe bringt.
Wir beginnen mit dem Mittelalter im Landesmuseum, um dann in Gundersheim beim Hoffest zu Mittag zu essen. Hier lernen wir den Maler Daniel Wohlgemuth kennen, dessen Nachkommen seine künstlerisch gestalteten Weinetiketten als Schatz bewahren. Das nächste Ziel ist die ehemalige Wallfahrtskirche Zum Hl. Blut in Armsheim, die, 1431 errichtet, heute noch als „schönste Dorfkirche Rheinhessens“ gilt.
Nun fahren wir weiter nach Partenheim. Erstmals 757 urkundlich erwähnt, war es bis zur Okkupation durch die Franzosen im gemeinschaftlichen Besitz der Freiherrn von Wallbrunn und von Wambold. Auch hier steht eine einstige Wallfahrtsstätte im Mittelpunkt unseres Besuchs: Die heutige evangelische Pfarrkirche hat noch viel von ihrer Ausstattung des 15. Jahrhunderts bewahrt, wenngleich sich die gotischen Tafeln des Hl.-Blut-Altars im Mainzer Landesmuseum befinden.
In Guntersblum werfen wir einen Blick auf die „Heidentürme“, Kirchtürme von einer „orientalischen Kuppel“ bekrönt. Man weiß zwar, dass sie in der Zeit nach dem Ersten Kreuzzug entstanden sein müssen, über ihre Bedeutung und darüber, wer sie errichtet hat, kann jedoch nur gemutmaßt werden.
Ganz besondere Bauwerke sind die für Rheinhessen typischen „Kuhkapellen“. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als Kirchenbauten im Departement du Mont-Tonnere nicht errichtet wurden, schufen Baumeister Ställe mit Kreuzgewölben, die feuersicher waren. Heute sind viele der oft sorgfältig gestalteten Räume zu Weinlokalen oder Restaurants ausgebaut. Wir werden unsere Exkursion in einer der schönsten Kuhkapellen in Dexheim mit einem Imbiss beenden.
Landesausstellung "Kaiser Karl IV." in Nürnberg
4.-5. November 2016
Der Freistaat Bayern und die Tschechische Republik nehmen den 700. Geburtstag Kaiser Karls IV. zum Anlass für eine gemeinsame Landesausstellung. Karl IV. gehört zu den bedeutendsten Herrschern des deutschen Spätmittelalters. Sein Name ist untrennbar mit der Goldenen Bulle von 1356 verbunden, dem Grundgesetz des römisch-deutschen Reiches, das die Wahl des Königs bzw. künftigen Kaisers durch die Kurfürsten regelte und auch die herausragende Stellung des Mainzer Erzbischofs als zweiten Manns im Reich festschrieb.
Wir bieten unseren Mitgliedern und Gästen eine außerordentliche zweitägige Reise zu dieser Ausstellung an. Unsere Reise nach Nürnberg führt uns durch das romantische Schnaittachtal in der Fränkischen Alp zum Rothenberg mit Europas größter Barockfestung. Eine Vorgängeranlage dieser Festung diente Karl IV. als militärische Station. Unser Mittagessen nehmen wir am Fuße des Rothenbergs ein mit einem atemberaubenden Blick in die Fränkische Alp. Weiter führt uns die Reise nach Lauf an der Pegnitz. Wir werden durch die Altstadt geführt und besichtigen den historischen Wappensaal in der Kaiserburg, die Karl IV. 1356 erbauen ließ.
In Nürnberg angekommen beziehen wir unsere Zimmer im Hotel „Agneshof“ und treffen uns zum Abendessen in der „Barfüßer-Brauerei“.
Am nächsten Tag besuchen wir das Ziel unserer Reise, die Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum. Etwa 140 Exponate präsentieren einen neuen und spannenden Blick auf den Herrscher und sein Jahrhundert. Nach der Mittagspause werden wir unter dem Titel „Goldene Bulle, Goldene Straße, goldene Zeit?“ noch eine Stadt- https://regionalgeschichte.net/und Burgführung haben, die unser Thema Karl IV. abrunden wird.
„175 Jahre Taunus-Eisenbahn (Frankfurt am Main - Höchst - Kastel - Wiesbaden)“
Bernhard Hager M.A. (Frankfurt a. M.)
Montag, 5. Januar 2015, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Mit der 1839/40 abschnittsweise dem Verkehr übergebenen Taunus-Eisenbahn von Frankfurt am Main über Höchst und Kastel begann das Eisenbahnzeitalter im Rhein-Main-Gebiet. Die Taunus-Eisenbahn war bereits die zehnte deutsche Bahnlinie. Erstmalig im deutschen Raum wurde hierbei eine Staatsgrenze, nämlich jene zwischen der Freien Stadt Frankfurt und dem Herzogtum Nassau, überschritten. Der Vortrag lässt die durch unterschiedliche Interessenlagen der von der Strecke berührten Staaten (Großherzogtum Hessen-Darmstadt, Herzogtum Nassau und Freie Stadt Frankfurt) geprägte Entstehungsgeschichte der Taunus-Eisenbahn Revue passieren. Hierbei wird auch auf die Rolle der Stadt Mainz und der Bundesfestung Mainz eingegangen.
„Papierne Monumente? Leichenpredigten im Trauerzeremoniell für die Mainzer Kurfürsten des 18. Jahrhunderts“
Jan Turinski, M.A. (Mainz)
Montag, 2. Februar 2015, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Am 30. Januar 1729 verstarb der Mainzer Kurfürst und Erzbischof, Lothar Franz von Schönborn. In den folgenden Wochen wurde nun der Dompfarrer, Caspar Adam Betz von Arenberg, vor die Aufgabe gestellt, eine Leichenpredigt zu konzipieren, durch die der Verstorbene im Rahmen der Ende März stattfindenden Trauerfeierlichkeiten geehrt werden sollte. Erschwert wurde die ohnehin nicht einfache Aufgabe für den Geistlichen durch den Facettenreichtum des Mainzer Kurfürstenamtes im 18. Jahrhundert: Lothar Franz von Schönborn war zugleich Landesherr des Erzstiftes Mainz, Diözesanbischof und Seelenhirte im Mainzer Erzbistum, einer der wichtigsten Reichsfürsten und überdies hinaus auch Mitglied einer reichsritterlichen Familie.
Der Vortrag geht der Frage nach, welches Bild von Lothar Franz von Schönborn und seinen Nachfolgern auf der Kurmainzer Kathedra vor dem Hintergrund dieses vielfältigen Aufgabenspektrums in den auf sie gehaltenen Leichenpredigten gezeichnet worden ist. In diesem Zusammenhang wird auch ein Einblick in den Ablauf der Kurmainzer Sepulkral- und Trauerfeierlichkeiten des 18. Jahrhunderts gegeben. Nicht zuletzt beleuchtet der Vortrag auch die Facetten und Eigenarten frühneuzeitlich-katholischer Leichenpredigten, einer Quellengattung, die von der historischen Forschung lange Zeit vernachlässigt worden ist.
„Kirche und Gesellschaft in Mainz am Vorabend der Reformation“
Prof. Dr. Wolfgang Dobras (Mainz)
Montag, 2. März 2015, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Die Jahrzehnte vor dem Auftreten Luthers waren von einer blühenden Frömmigkeits- praxis geprägt, die in einem intensivierten Reliquienkult, in Wallfahrten, der Gründung von Bruderschaften und Ablasskampagnen zum Ausdruck kam. Gleichzeitig und gerade wegen der Sehnsucht der Menschen nach dem göttlichen Heil wurde auch massive Kritik an der Kirche geübt. Am Beispiel der erzbischöflichen Metropole Mainz beleuchtet der Vortrag die unterschiedlichen Frömmigkeitsformen, aber auch kirchliche Missstände, Reformbestrebungen und antiklerikale Strömungen.
Die Architektur der Synagogen Europas
Vortrag, 22.06.2015, 18.00 Uhr
Neue Synagoge Mainz
Synagogenplatz
55118 Mainz
Die US-amerikanische Kunsthistorikerin Prof. Dr. Carol Herselle Krinsky lehrt an der New York University. Sie ist Autorin des Standardwerkes "Europas Synagogen – Architektur, Geschichte und Bedeutung" (1985/1988).
Begrüßung: Stella Schindler-Siegreich, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mainz
Einführung: Dr. Joachim Glatz, Landeskonservator
Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist auf Deutsch.
Veranstalter:
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Mainz
Eine Synagoge unterscheidet sich als religiöses Gebäude von einer Kirche: Es ist ein Ort des Gottesdienstes, des Lernens und der Gemeinschaft, weniger einer des übernatürlichen Geschehens. Ihre Architektur macht die Stellung ihrer Auftraggeber und Förderer innerhalb der Gesellschaft sehr klar deutlich. Den europäischen Synagogen wurden in der Vergangenheit in ihrer baulichen und künstlerischen Entfaltung durch die Gesetze der Mehrheit Grenzen gesetzt, sie nahmen jedoch sehr wohl an der architektonischen Gesamtentwicklung teil – insbesondere weil sie oft von Christen entworfen und gebaut wurden. Seit der rechtlichen Emanzipation der jüdischen Gemeinden boten sich Möglichkeiten für eine weniger eingeschränkte Selbstdarstellung, aber die Gebäude zeigten weiterhin ein Bewusstsein für die mögliche Reaktion der Mehrheitsbevölkerung. Synagogen des Zwanzigsten Jahrhunderts, gerade die in Deutschland, reagierten auf die politischen Zeitströmungen. Die sehr unterschiedlichen Ausdrucksformen der jüngsten Zeit ab 1989 lassen dann auch eine neue Phase im Verhältnis von Minderheit und Mehrheit erkennen.
Ermittlungen zu Hans Junckers Wirken im Mainzer Dom: Vom Nassauer Altar bis zum Riedt'schen Altar
Cornelius Lange MA (Würzburg)
Montag, 28. September 2015, 18.00 Uhr
im MVB-Forum
Der Ruhm des Bildhauers Hans Juncker (1581/82-1624/26) ist vor allem in seinen Aschaffenburger Skulpturen begründet. Seine größte Schöpfung ist der Hochaltar der Kapelle im kurmainzischen Schloss zu Aschaffenburg, er wird als Hauptwerk deutscher Bildhauerkunst der späten Renaissance gefeiert. Welche Werke im Mainzer Dom ihm ganz oder teilweise zugerechnet werden können, ist allerdings noch immer unklar. Bildwerke, die das Bild des Mainzer Domes bis heute prägen, wie der „Petrus-ad-vincula“-Altar für die Gebrüder von Nassau-Sporkenburg oder der Epitaphaltar des Jodokus von Riedt (und andere mehr) wurden mit Hans Juncker, aber auch mit anderen Künstlern in Verbindung gebracht. Der Vortrag bietet einen Überblick über die mit Juncker assoziierten Grabdenkmäler. Dabei steht die Frage der Zuschreibung im Mittelpunkt und wird mithilfe neuer Gedanken und Erkenntnisse erörtert. Zugleich ist der Vortrag eine hervorragende Gelegenheit zur Einstimmung auf die MAV-Exkursion nach Aschaffenburg am 3. Oktober 2015, auch wenn selbstverständ-lich beide Veranstaltungen unabhängig voneinander konzipiert sind.
Die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz auf dem Weg zum Welterbe
Dr. Joachim Glatz, Landeskonservator a.D. (Mainz)
Montag, 2. November 2015, 18.30 Uhr
im MVB-Forum (nach der Jahresmitgliederversammlung)
In den rheinischen Bischofsstädten Mainz, Worms und Speyer bildeten Juden seit dem 10. Jahrhun-dert Gemeinden, die zu den frühesten Europas gehörten. Sie formierten den einzigartigen Verbund der SchUM-Städte, der die Kultur, Religion und Rechtsprechung in der aschkenasischen Diaspora maßgeblich geprägt hat. Beschlüsse und Verordnungen der Rabbinerkonferenzen waren verbindlich für das gesamte westeuropäische Judentum.
Das Land Rheinland-Pfalz hat die drei SchUM-Städte mit ihren jüdischen Kulturdenkmälern für die Aufnahme in die Welterbeliste vorgeschlagen. Die Direktion Landesdenkmalpflege in der General-direktion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz wurde beauftragt, den Welterbeantrag mit verschiedenen Partnern zu erarbeiten. Der Vortrag behandelt die Thematik unter besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Zeug-nisse in Mainz. Hier kommt der neuen Synagoge eine besondere Rolle zu. Sie schlägt den Bogen vom Mittelalter, dem Gedenkstein für Gerschom ben Jehuda auf dem Denkmalfriedhof am Juden-sand, über alle Wirren und Katastrophen hinweg bis zur Gegenwart.
Dargestellt werden die drei SchUM-Städte mit ihren Zeugnissen jüdischer Kultur des Mittelalters. So hat sich in Mainz der älteste datierbare jüdische Grabstein Westeuropas von 1049 erhalten (Lan-desmuseum). Trotz der Verluste der Bauten des mittelalterlichen Judenquartiers gibt es auch in Mainz noch zahl-reiche Hinweise auf diese wichtige Epoche der Zeit zwischen 1000 und 1350.
Das römische Legionslager von Mogontiacum/Mainz: Neue Forschungen zur Topographie und Umwehrung
Daniel Burger M.A. (Frankfurt a. M.)
Montag, 7. Dezember 2015, 18.00 Uhr
im MVB-Forum
Die Errichtung des römischen Legionslagers 13/12 v. Chr. gilt als Gründungsdatum von Mainz und ist somit untrennbar mit der Stadtgeschichte verbunden.
Mit seiner strategischen Lage auf dem Hochplateau gegenüber der Mainmündung gehörte es zu den wichtigsten Militäranlagen am Rhein und diente als Ausgangspunkt zahlreicher römischer Feldzüge gegen germanische Stämme. Im Vergleich zu anderen Legionslagern ist vom Mainzer Castrum al-lerdings nur wenig bekannt. Grabungen in den letzten Jahren erbrachten jedoch neue und spannende Ergebnisse, die derzeit in einer Forschungsarbeit ausgewertet werden. Neben einem Einblick in die laufenden Arbeiten erläutert der Vortrag exemplarisch auch die Entwicklung der römischen Stadt Mainz.
Sonderausstellung „Residenz - Festung - Kurstadt 1914-1918: Darmstadt, Mainz und Wiesbaden im Ersten Weltkrieg“
Mittwoch, 18. November 2015, 17.00 Uhr
im Stadtarchiv Mainz, Rheinallee 3 B
Der Erste Weltkrieg führte nicht nur zu gewaltigen politischen, sozialen und kulturellen Umwäl-zungen in Deutschland und Europa, sondern brachte auch enorme Belastungen für die deutschen Kommunen mit sich. Nichts war im Jahr 1919 in Darmstadt, Mainz und Wiesbaden noch so wie zu Beginn des Jahres 1914. Alle Lebensbereiche waren vom Krieg und seinen Folgen betroffen, alle Teile der Stadtgesellschaft litten unter seinen Auswirkungen.
Die Ausstellung stellt die Auswirkungen des Kriegs auf die so genannte „Heimatfront“ dar und fragt nach Gemeinsamkeiten und individuellen Entwicklungstendenzen in den drei Städten. Themen sind der Kriegsausbruch und die Kriegsbegeisterung in Teilen der Bevölkerung, die Desillusionie-rung der Stadtgesellschaften mit zunehmender Kriegsdauer, die bald allgegenwärtigen Versor-gungsnöte, die durch den Krieg hervorgerufenen sozialen Probleme und schließlich das dramatische Kriegsende mit Novemberrevolution und französischer Besetzung. Bei der Präsentation der Ausstellung im Stadtarchiv Mainz sind erstmals zahlreiche Originale, die ein eindrucksvolles Bild vom Alltag der Menschen in Mainz während des Ersten Weltkriegs geben, zu sehen. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die Geschichte des Offiziersgefangenenla-gers, das im Ersten Weltkrieg auf der Zitadelle in Mainz eingerichtet worden war. In Kooperation mit dem Mainzer Garnisonsmuseum werden Exponate zum Lager, darunter auch wertvolle Stücke aus dem Nachlass des französischen Majors Sylvain Eugène Raynal (1867-1939), gezeigt.
Der Kurator der Ausstellung, unser Vorstandsmitglied Dr. Frank Teske, bietet allen interessierten MAV-Mitgliedern eine Führung durch die Ausstellung an. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Treffpunkt ist um 17.00 Uhr im Foyer von Stadtarchiv und Stadtbibliothek.
Führung über den alten jüdischen Friedhof / Denkmalfriedhof
Dr. Joachim Glatz (Mainz)
Sonntag, 26. April 2015, 10.00 Uhr, alter jüdischer Friedhof (Mombacher Straße)
Der alte jüdische Friedhof (Judensand) entstand in der Nachfolge römischer Gräberfelder stadtauswärts in der Straßengabelung zwischen Fritz-Kohl-Straße und Mombacher Straße.
Der Friedhof weist heute 1500 Grabsteine der Zeit um 1700-1880 auf, als dann auch die Juden ihre Bestattungen auf dem neuen Hauptfriedhof vornehmen mussten. Von herausragender Bedeutung ist der sogenannte Denkmalfriedhof, den Rabbiner Sali Levi 1926 anlegen ließ. Es wurden Grabsteine des Mittelalters aufgestellt, die sich ursprünglich hier befunden hatten, aber schon in Laufe des Mittelalters als Baumaterial zweckentfremdet worden waren. Es handelt sich um rund 200 Steine des Mittelalters; die frühesten stammen aus dem 11. Jahrhundert.
Im Zusammenhang mit den Bemühungen des Landes Rheinland-Pfalz um Anerkennung der SchUM-Städte (Speyer, Worms und Mainz) als Welterbe spielt der Denkmalfriedhof in Mainz mit seinen Steinen eine herausragende Rolle als wichtiges Zeugnis der jüdischen Kultur des Mittelalters. Hier sind bedeutende jüdische Gelehrte begraben, welche entscheidend zur Bedeutung der SchUM-Städte mit ihren Impulsen für die gesamte jüdische Welt beigetragen haben. Ein Gedenkstein erinnert beispielsweise an Gerschom-ben-Jehuda, der in der Zeit um 1000 in Mainz lebte und dem die neue Synagoge gewidmet ist, ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der Tradition im Judentum.
Treffpunkt für alle Interessierte ist der Haupteingang an der Mombacher Straße. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen!
Landesausstellung in Sachsen-Anhalt "Cranach der Jüngere" vom 9.-12. Juli 2015
Ein Jahrhundertereignis findet dieses Jahr in Sachsen-Anhalt statt. Die Landesausstellung „Cranach der Jüngere 2015“ ist weltweit die erste große Ausstellung, die sich ausschließlich Lucas Cranach d.J. widmet. Anlässlich seines 500. Geburtstags kann man an originalen Schauplätzen Wissenswertes über ihn und sein Umfeld erfahren.
Ein umfangreiches Programm, das uns über Halle zu den Ausstellungsorten in Dessau, Wörlitz und Wittenberg und auf der Heimreise nach Eisenach und zur Wartburg führt, wird Ihnen ein außerordentliches Erlebnis bereiten.
Auf der Hinreise werden wir in Halle zu Mittag essen und nach einer Stadtführung beim Besuch im Museum die Himmelsscheibe von Nebra aus der Bronzezeit bestaunen. Danach fahren wir zu unserem Hotel in Dessau.
Am zweiten Tag besuchen wir hier die Ausstellungsorte Johannbau, Marienkirche sowie die Johanniskirche.
Der Nachmittag gehört dem berühmten Wörlitzer Park und dem Ausstellungsort „Gotisches Haus“. Wir spazieren mit Begleitung durch den Park und erleben eine stimmungsvolle Gondelfahrt.
Den dritten Tag werden wir in Wittenberg verbringen. Hier in „Cranach City“ besuchen wir das Augusteum, die Stadtkirche St. Marien und das Cranach Haus. Auf der Heimreise werden wir uns nach einem Rundgang in Eisenach und nach einer Führung auf der Wartburg bei einem Imbiss und mit Blick weit ins Land verabschieden.
Aschaffenburg. Das Wirken der Mainzer Kurfürsten am Main
Exkursion am Samstag, 3. OKTOBER 2015
Besucher von Aschaffenburg stoßen auf Schritt und Tritt auf Mainzer Geschichte. Fast 1000 Jahre stand die Stadt unter der Herrschaft der Kur-Erzbischöfe von Mainz und wurde 1794 noch für fast 20 Jahre die Residenz und der Regierungssitz des letzten geistlichen Staates in der Nachfolge von Kurmainz.
Der Spaziergang durch die Altstadt beginnt in der romanischen Stiftskirche St. Peter und Alexander, wo die Grablegen von Albrecht von Brandenburg und Friedrich Carl Joseph von Erthal im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Auch dem Schaffen von Matthias Grünewald wird hier nachgespürt.
Das einstige Residenzschloss Johannisburg beherbergt u.a. die kurmainzische Gemäldegalerie mit wichtigen Werken der Cranach-Schule, die Carl Theodor von Dalberg als eine der ersten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands einrichtete. Die Schlosskapelle mit dem Hochaltar von Hans Juncker für den Bauherrn Johann Schweikart von Kronberg ist seit der Neupräsentation 2014 in buchstäblich neuem Licht zu sehen.
Der Tag klingt im Landschaftspark Schönbusch aus, einem frühen „englischen“ Garten auf deutschem Boden. Der Park wurde auch in der bayerischen Zeit nach 1814 kaum verändert und gab entscheidende Anregungen für die Blüte der Landschaftsgärtnerei des 19. Jahrhunderts.
Kriegspläne für Rheinhessen. Die Festung Mainz im Ersten Weltkrieg
Montag, 6. Januar 2014, 18 Uhr im MVB-Forum
Dr. Rudolf BÜLLESBACH (Mainz)
Vor und während des Ersten Weltkriegs entstand in Mainz und im rheinhessischen Umland eine der wichtigsten Festungen im Westen des Deutschen Reiches. Es war der letzte Abschnitt einer Geschichte, die Mainz über mehrere Jahrhunderte als bedeutende Festungsstadt geprägt hatte. Bis 1918 bildeten in Mainz vierzehn große Forts den inneren Festungsring. Von Ingelheim über Heidenfahrt, Heidesheim, Wackernheim, Essenheim, Ober-Olm, Nieder-Olm bis zu den heutigen Mainzer Vororten Ebersheim, Hechtsheim und Weisenau erstreckten sich über 350 moderne Festungswerke, Lagerplätze, Wasserwerke und Fernmeldestationen im Halbkreis als äußerer Festungsring. Die Versorgung und der Nachschub waren durch ein militärisches, über 40 km langes Straßen- und Bahnnetz sowie eine Zahnradbahn in Ingelheim sichergestellt. Mit 30.000 Soldaten und Arbeitern waren für den Bau der Festung Mainz bereits kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges so viele Menschen im Einsatz wie in Ägypten für den Bau der Cheopspyramide.
Dieser gigantische Aufwand diente einem klaren Zweck. Nach den Vorstellungen des deutschen Kaisers und des Generalstabs waren Mainz und Rheinhessen ein denkbarer Kriegsschauplatz. Wie es dazu kam und welche Rolle die Festung Mainz bei den Planungen des Ersten Weltkriegs konkret spielte, ist Gegenstand des Vortrags.
„Das prächtigste Amphitheater, das die Natur je gebildet hat“. Mainzer Ansichten von Christian Georg Schütz und bei Reisenden seiner Zeit
Montag, 3. Februar 2014, 18 Uhr im MVB-Forum
Dr. Gerhard KÖLSCH (Mainz)
Johann Isaak von Gerning beschrieb die Rheingegend ab Mainz als „schön und erhaben zugleich“, ja als paradiesisches Land, „wie Neapels Gegend, ein Stück des Himmels, herabgefallen zur Erde“, und weitere Reisende wie Heinse oder Goethe stimmen in das Lob dieser Gefilde ein. Der Frankfurter Künstler Christian Georg Schütz der Ältere schuf mit einem wenig bekannten Gemäldezyklus entsprechende Ansichten von Mainz und seiner prächtigen Umgebung, die das künstlerische Bild der Stadt prägten. Der Vortrag zeichnet die ästhetische Wahrnehmung von Stadt, Fluss und Landschaft nach, und ein Gang an die heutigen Standorte lässt einen Blick auf die Arbeitsweise des Landschaftsmalers zu. Nicht zuletzt werden dabei die tief greifenden Veränderungen der Gegend in rund zweihundert Jahren sichtbar.
Die Mainzer Malerfamilie Hoch
Montag, 10. März 2014, 18 Uhr im MVB-Forum
Dr. Miriam HOCH-GIMBER (Eltville)
Der Vortrag beleuchtet eine Epoche der Mainzer Kunstgeschichte des 18. und beginnenden 19. Jhs. anhand der von den Zeitgenossen sehr geschätzten Malerfamilie Hoch. In einem Überblick werden die einzelnen Mitglieder vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf dem Leben und Werk Johann Jacob Hochs (1750–1829), der für die hiesige Geschichte höchst interessante Zeitdokumente geschaffen hat. Seine detailreiche Zeichnung einer Sitzung des Mainzer Jakobinerclubs aus dem Jahre 1792 gibt dem Betrachter einen lebendigen Einblick in das Kapitel der „Mainzer Republik“. Er dokumentierte auch das Ausmaß des Elends der Typhus-Epidemie, die Mainz im Winter 1813/14 heimsuchte. Hinzu kommen zahlreiche Gemälde und Zeichnungen sakraler und profaner Bauwerke aus Mainz und Umgebung, die zum Teil nicht mehr existieren, z.B. die Liebfrauenkirche, das Kloster Dalheim und das Peterstor. Johann Jacob Hoch hielt zudem ein beliebtes Ausflugsziel, nämlich die Kegelbahn im Lennebergwald, bildlich fest. Gezeigt werden Bilder der Mainzer Malerfamilie Hoch aus öffentlichen Sammlungen und aus Privatbesitz, die in jahrelanger Recherche zusammengetragen wurden. Die Qualität der Werke beweist, dass die Hochs weitaus mehr als „Provinzkünstler“ waren.
Die Mainzer Memorbücher als Quelle der jüdischen Geschichte
Prof. Dr. Andreas LEHNARDT (Mainz)
Die Mainzer Memorbücher als Quelle der jüdischen Geschichte
Im Jahre 1869 veröffentlichte der Mainzer liberale Rabbiner Siegmund Salfeld das berühmte Martyrologium des Nürnberger Memorbuches. Die dieser kommentierten Edition zugrundeliegende Handschrift einer der wichtigsten Quellen für die Geschichte des deutschen Judentums galt lange als verschollen, und ihr genauer Verbleib war nicht geklärt. Nun ist die wichtige Handschrift in Israel wieder aufgetaucht, wo sie sich in Privatbesitz befindet. Die erste Untersuchung der Handschrift durch Experten ergab, dass die Edition Salfelds viele Fragen aufwirft, die gründlicherer Erforschung bedürfen. Außer diesem berühmten Memorbuch aus Mainz gibt es noch drei weitere Memorbücher, die sich bis zu der Shoah in der Stadt befanden. Diese Manuskripte befinden sich heute in den Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem. Sie sind für die Stadtgeschichte und die Geschichte der Juden in Deutschland bislang nicht erschlossen. Erste Untersuchungen zeigen, dass sie nicht nur in genealogischer Hinsicht von Bedeutung sind, sondern auch im Hinblick auf die Gemeindegeschichte, die Onomatologie und die allgemeine jüdische Geschichte. Der Vortrag möchte die spannende Geschichte der Rettung der Mainzer Memorbücher in Erinnerung rufen, die aktuelle Forschungslage erläutern und die Perspektiven zukünftiger Forschungen aufzeigen.
Montag, 29. September 2014, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Karl der Große in und um Mainz (ausgefallen)
Prof. Dr. Franz J. FELTEN (Mainz)
Karl der Große in und um Mainz
Der Vortrag sucht Antworten auf folgende Fragen: Wann war Karl in Mainz und der Umgebung und was tat er dort? Wo hielt er sich auf, wenn er hier war – womöglich in einer eigenen Pfalz in der Stadt? Wie war der Herrscher präsent, wenn er nicht persönlich anwesend war und wie lebte er in der Erinnerung in Mainz weiter? Die Befunde für Mainz sind im Vergleich mit denen für Ingelheim, Frankfurt und Worms, aber auch mit denen für die anderen rheinischen Metropolen Trier und Köln zu interpretieren.
Montag, 3. November 2014, 19.00 Uhr im MVB-Forum (nach der Jahresmitgliederversammlung)
Mainz im Ersten Weltkrieg
Dr. Frank TESKE (Mainz) „Mainz im Ersten Weltkrieg“
Der Erste Weltkrieg erfährt anlässlich des 100. Jahrestages seines Ausbruchs eine nie da gewesene Aufmerksamkeit. Zahlreiche Publikationen und Ausstellungen nehmen sich des gleichermaßen dramatischen wie denkwürdigen Geschehens der Jahre 1914-1918 an, das unübersehbare Folgen auch für die Entwicklung der deutschen Kommunen mit sich brachte. Alle Lebensbereiche in den Städten waren in den Krieg und seine Folgen einbezogen, alle Teile der Stadtgesellschaft litten unter den Auswirkungen.
Der Vortrag beleuchtet das Leben an der „Heimatfront“ in der Festungsstadt Mainz. Er zeigt auf, wie auch hier im August 1914 die Kriegsbegeisterung um sich griff und erst mit zunehmender Kriegsdauer und steigenden Gefallenenzahlen den Realitäten des Kriegsalltags wich. Versorgungskrisen, Lebensmittelrationierungen und soziale Probleme im Zusammenhang mit der Einberufung von zahlreichen Familienvätern ließen Risse in der Heimatfront entstehen, auch wenn der Durchhaltewillen der Bevölkerung und deren Treue zum Kaiser lange Zeit ungebrochen schienen. Erst im Spätjahr 1918 führten schließlich wie in ganz Deutschland auch in Mainz die Kriegsmüdigkeit der Menschen und die Enttäuschung über die herrschenden Eliten zum Umsturz im Zuge der Novemberrevolution.
Montag, 3. November 2014, 19.00 Uhr im MVB-Forum (nach der Jahreshauptversammlung)
Denkmalgedanken aus dem Süden. Giovanni Battista Michelettis Initiative für ein Mainzer Gutenberg-Monument 1814
Dr. Kai-Michael SPRENGER (Mainz)
Denkmalgedanken aus dem Süden. Giovanni Battista Michelettis Initiative für ein Mainzer Gutenberg-Monument 1814
Im Jahre 1814 publizierte der italienische Gelehrte Giovanni Battista Micheletti (1762–1833) in L'Aquila eine kulturhistorische Betrachtung über den Wert der Erfindung des Buchdrucks. Diese wenig bekannte Schrift beinhaltet nicht nur ein Lob Gutenbergs, sondern zugleich eine eindringliche Ermahnung des Italieners an die Mainzer, ihrem berühmtesten Sohn wegen seiner Verdienste um die gesamte Menschheit doch endlich ein Monument zu errichten und somit eine längst überfällige Ehrenschuld einzulösen.
Der Vortrag stellt die interessante Schrift, ihren Autor und dessen geistiges Umfeld wie auch die wenig bekannte Denkmalinitiative vor, die der Mainzer Redakteur und Historiker Friedrich Lehne aufgriff und in Mainz zu befördern versuchte. Wenngleich diese Bemühungen Lehnes nicht direkt umgesetzt werden konnten, so steht die Initiative doch am Beginn einer neuen bürgerlichen Gutenberg-Rezeption und -begeisterung in Mainz, die schließlich 1827 zur Errichtung des ersten figürlichen Gutenberg-Standbildes durch den Bildhauer Joseph Scholl führen sollte, für das ebenfalls Friedrich Lehne als Motor wie auch als Autor der Inschrift zeichnete. Nicht zuletzt spürt der Vortrag den persönlichen Beziehungen zwischen Micheletti und Lehne nach, dessen persönliches Widmungsexemplar der Micheletti-Schrift erhalten geblieben ist.
Montag, 1. Dezember 2014, 18.00 Uhr im MVB-Forum
Sonderausstellung „Franz von Kesselstatt (1753-1841). Mainzer Domherr, Diplomat und Dilettant in bewegter Zeit.“
BESUCH DER SONDERAUSSTELLUNG „Franz von Kesselstatt (1753-1841).
Mainzer Domherr, Diplomat und Dilettant in bewegter Zeit.“
Das Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum Mainz bietet den Mitgliedern des Mainzer Altertumsvereins zum Sondertarif und zu einem ungestörten Termin außerhalb der Öffnungszeiten eine Führung durch die genannte Sonderausstellung an. Treffpunkt ist der Eingang vor dem Museum in der Domstraße („im Kalten Loch“) gegen 16.50 Uhr.
Die Teilnehmergebühr in Höhe von 7,- Euro (ermäßigter Preis) wird vor Ort bar eingesammelt. Ihre verbindliche Anmeldung richten Sie bitte bis spätestens Ende August schriftlich (formlos) an die Adresse unseres stellvertretenden Vorsitzenden (wegen vieler Abwesenheiten und schlechter telefonischer Erreichbarkeit im Sommer):
Dr. Franz Stephan Pelgen
Obere Auflangenstraße 1
55283 Nierstein
pelgen(at)mail.uni-mainz.de
Freitag, 12. September 2014, 17.00 Uhr im Dom- und Diözesanmuseum Mainz
Die Führung durch die Ausstellung ist für alle Interessierte eine wunderbare Gelegenheit zur Vorbereitung der Kesselstatt-Exkursion, die der MAV am Freitag, 3. Oktober 2014, durchführt!
EXKURSION IN DEN HUNSRÜCK
THEMA: „HEIMAT 3 - DIE ANDERE HEIMAT "
Organisation und Leitung: Dr. Reinhard Schmid
In seiner vielbeachteten, in den Jahren zwischen 1981 und 2003 gedrehten Heimat-Trilogie schildert Edgar Reitz die Geschichte der Familie Simon aus dem fiktiven Hunsrückdorf Schabbach in den Jahren zwischen 1919 und 2000. Mit dem Film „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht“ führte Reitz 2013 dieses Thema fort, allerdings nicht mehr als mehrteilige Fernsehserie, sondern als zweieinhalbstündigen, vielfach ausgezeichneten Kinofilm. Lokaler Mittelpunkt des Geschehens ist wieder Schabbach, allerdings in der von einer großen Auswanderungswelle aus dem Hunsrück gekennzeichneten Zeit um 1840. Der Film schildert in eindringlichen Bildern die Motive der Auswanderer, die Nöte, aber auch die kleinen Freuden der Hunsrückbewohner dieser Zeit.
Nachdem der Mainzer Altertumsverein unter seinem früheren Vorsitzenden Prof. Dr. Helmut Mathy sich schon an die Stätten der Heimat-Trilogie begeben hatte, wollen wir nun auch den Spuren der „Anderen Heimat“ im Hunsrück folgen. Herr Dr. Fritz Schellack, Leiter des Hunsrück-Museums in Simmern, der Edgar Reitz bei den Dreharbeiten beraten hat, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns an diesem Tag zu begleiten.
SAMSTAG, 13. SEPTEMBER 2014
09:30 Uhr:|Abfahrt Mainz Hbf, Nordsperre
<span class="nowrap">10:30 – 11:30:</span>|Führung durch das Hunsrück - Museum
11:45 – 12:45:|Mittagessen in Simmern
13:00:|Weiterfahrt nach Sargenroth. Nunkirche mit Fresken aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Außerdem: die Filmgräber der Familie Simon.
13:45 – 15:00:|Gehlweiler. Wenn man so will, das eigentliche „Schabbach“ des Filmes „Die andere Heimat“. Hier haben wir in Helma Hammen eine äußerst kundige Führerin durch Ort und Kulissen, da sie nicht nur das Casting für die Regionalschauspieler in „Heimat 3“ und „Die andere Heimat“ gemacht, sondern auch selbst mitgespielt hat. Zum Abschluss des Rundganges in Gehlweiler gibt es Kaffee und leckeren, selbstgebackenen Blechkuchen.
15:15 – 15:45:|Schlierschied (Landwirtschaft 1840, großer Treck, Woppenroth)
ca. 17:00:|Schlusseinkehr im Gemündener Hof in Gemünden, wo auch die Gelegenheit zu einem Abendimbiss besteht.
ca. 18:30:|Rückfahrt
Zu Gast bei den Grafen von Kesselstatt in Trier, Föhren und Kröv
Die diesjährige Ausstellung des Mainzer Dommuseums über Franz von Kesselstatt bietet Anlass, den Spuren dieser reichsritterlichen Familie an der Mosel nachzugehen, wo sie seit dem 15. Jahrhundert ansässig ist.
Die Exkursion legt den Schwerpunkt auf Orte, die sonst nicht ohne weiteres zugänglich sind.
Neben der Stadt Trier stehen mit Föhren und Kröv beschaulich-ländliche Ziele auf dem Programm dieser Tagesfahrt.
Mit dem von Mainzer Künstlern entworfenen Palais Kesselstatt haben die Bauherren einen bedeutenden Beitrag zur deutschen Architektur des Spätbarock geleistet, während das Stammschloss Föhren eine über mehrere Generationen gewachsene Anlage ist, die auch heute noch viel von der Lebenswelt des Adels vermittelt.
Unser Programm umfasst folgende Punkte:
- Trier, Liebfrauenkirche mit den Grabdenkmälern der Familie Kesselstatt,
- Palais Kesselstatt, exklusive Führung in den Weinkellern mit Verkostung,
- Mittagessen, Weinstube Kesselstatt (eigene Rechnung),
- Schloss Föhren, Empfang durch Alexandra Reichsgräfin von Kesselstatt,
- Exklusive Besichtigung der historischen Räume und des Schlossgartens,
- Kröv, Besichtigung der Grabkapelle der Grafen von Kesselstatt in den Weinbergen,
- Ausklang im klassizistischen Karolingerhof (eigene Rechnung).
FREITAG, 03. OKTOBER 2014
Abfahrt: 07.00 Uhr, Hauptbahnhof Mainz, Nordsperre
Rückkehr: ca. 21.00 Uhr
Preis für Mitglieder € 50, für Gäste € 55
Leistungen: Busfahrt, Führungen und Eintritte, Weinverkostung
Wenn Sie mitfahren möchten, überweisen Sie bitte den Betrag unter Angabe des Reiseziels, Ihres Vor- und Zunamens und Ihrer Telefonnummer auf das Konto des MAV bei der MVB, KTO-NR 22 099 022, BLZ 551 900 00.
Bei Rücktritt nach dem 15. September behalten wir € 10 als Kostendeckungsbeitrag zurück.
Leitung: Gernot Frankhäuser und Thomas Hilsheimer
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: karin-wolff@kabelmail.de, oder Tel: 06131-53707.
350 Jahre Mainzer „Reduktion“ 1664
Samstag, 5. April 2014, 10–12 Uhr, in Erfurt, Festsaal des Rathauses, Fischmarkt Gemeinsame öffentliche Fachtagung des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt mit dem Mainzer Altertumsverein.
PD Dr. Ulman Weiß (Universität Erfurt)
wird aus Erfurter Sicht zum Thema referieren.
PD Dr. Bettina Braun (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Städtische Freiheit versus landesherrliche Autorität: die Reduktion von Erfurt 1664
Die Reduktion von Erfurt durch den Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn im Jahre 1664 war kein singulärer Vorgang, sondern ist einzuordnen in eine Reihe ähnlicher Vorgänge im Nordwesten des Reichs in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Vortrag beleuchtet die Vorgänge in Erfurt vor diesem Hintergrund und fragt nach dem Verhältnis von städtischer Freiheit und landesherrlicher Autorität.
<media 32713 _top>Weitere Informationen zur Exkursion</media>
Mainzer Barock - ein vergessenes Erbe?
Trotz bedeutender Bau- und Kunstdenkmäler der Barockzeit in Mainz wie den Adelshöfen am Schillerplatz, den Pfarr-und Klosterkirchen oder Bauteilen des Domes wird Mainz kaum als barocke Stadt wahrgenommen. Dabei hatte die kurfürstliche Residenzstadt bereits unter Johann Philipp und Lothar Franz von Schönborn einen künstlerischen Aufschwung erfahren, der sich bis in das späte 18. Jahrhundert fortsetzte. Die verdienstvollen Arbeiten des Mainzer Kunsthistorikers Fritz Arens (1912-86) stehen für eine regionalhistorische Perspektive, die den Werken einer Kunstlandschaft ästhetische Gemeinsamkeiten, wiedererkennbar und benennbar, zuspricht. Doch in der aktuellen Forschung ist der Begriff des „Mainzer Barock" nach wie vor unklar. Wirken die regionalen Werkstätten mit hohem Auftragsvolumen stärker ein, oder prägen doch dominante Künstlerpersönlichkeiten die Region? Welche sozialen und politischen Rahmenbedingungen fanden geistliche wie weltliche Auftraggeber in Mainz vor? Der Fokus auf Mainz als verkehrsgünstig gelegener Umschlagplatz für Luxuswaren oder Kunstgüter mit finanziell gut gestelltem Domkapitel und deren Familien als Auftraggeber ermöglicht einen neuen, Zusammenhänge und Beziehungen erhellenden Blick auf bekannte Kunstwerke. Dabei spielen zugewanderte Künstler oder Kunstexporte eine wichtige Rolle. Kontakte unter Künstlern oder Künstlerfamilien auf der einen Seite wie auch die Netzwerke der großen Adelsgeschlechter als Auftraggeber andererseits dürften entscheidende Einflüsse ausgeübt haben. Die Tagung will anregen, die Eigenarten des „Mainzer Barock" in unterschiedliche Forschungsansätzen und den verschiedenen Gattungen herauszulesen und vergleichend zu diskutieren.
Haus m Dom, Mainz
17.-18. Oktober 2014